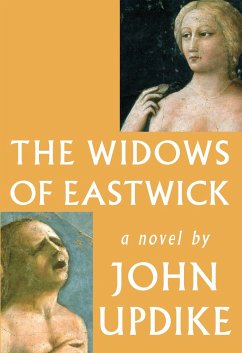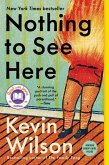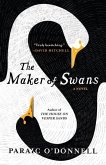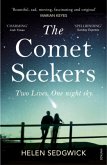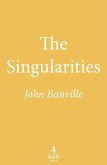Das Hexeneinmaleins der Verführung und der Zauber der bösen Zunge: Der letzte Roman, den John Updike vollenden konnte, ist sein Wiedersehen mit Eastwick.
Von Patrick Bahners
Das letzte Wort von John Updikes Roman "Die Hexen von Eastwick" aus dem Jahr 1984 heißt "Legende". Die Hexen sind aus Eastwick verschwunden, die drei geschiedenen Frauen sind neue Ehen eingegangen und haben sich aus dem Staub gemacht, den sie mit ihren Verführungstricks und ihren Zaubersprüchen in Küchenlatein aufgewirbelt hatten. Zum letzten Mal verwandelt sich die Erzählerstimme in das Organ des Gemeinschaftsbewusstseins der kleinen Stadt in Rhode Island, dem kleinsten der zur großen amerikanischen Republik vereinigten Staaten. In der ersten Person Plural legt die Gemeinde beziehungsweise ein namenloser Stadtschreiber oder vielleicht auch eine Anonyma das Bekenntnis ab, dass die Hexen im Bewusstsein der Stadt Spuren hinterlassen haben. Manchmal meint man sie an einer bestimmten Straßenecke noch davonfliegen zu sehen, es liegt noch etwas in der Luft, die Gerüchte von damals geben dem Namen der Stadt einen unverkennbaren Beigeschmack. Wie aufsteigender Rauch sich kräuselt, so wird wie von selbst durch Verdrehungen aus dem Skandal die Legende.
Dieser Schluss legt sowohl die Poetik des Romans offen als auch die soziologische Hypothese, der die Prämisse dieser ingeniösen Fiktion ihre geheime Plausibilität verdankt. Der alte Hexenmeister klappt seinen Chemiekasten auf. Dem Leser wird zu glauben zugemutet, dass es im entzauberten Amerika des Vietnamkrieges weise Frauen gegeben haben soll, die mit vereinten Willenskräften die Macht der Natur entfesseln konnten. Tatsächlich war die Wiedergewinnung eines durch den Terror des Patriarchats in den Untergrund gedrängten überlegenen Wissens der Frauen ein feministisches Projekt. Diese zeithistorische Tatsache gehört zu den äußeren Voraussetzungen von Updikes Experiment; sie legt nahe, den Roman als Satire auf den Feminismus zu lesen.
In dieser Intention geht der Roman aber nicht auf. Mit literarischen Kunstmitteln muss Updike die innere Glaubwürdigkeit seiner naturgesetzwidrig erdachten Kleinschöpfung erzeugen, und es gelingt ihm eine Verdichtung, die für allegorische Zwecke viel zu stark ausfällt. Zu real wirkt die Welt des Romans, die Welt, die Alexandra, Jane und Sukie, die drei Hexen von Eastwick, formen zu können meinen, als dass die Kritik feministischer Gegenmachtphantasien die Pointe sein dürfte. Der Eskapismus der trivialromantischen Hexenliteratur liegt zutage; zu seiner Entlarvung bedarf es keiner umständlichen Parodie. Das reiche Vergnügen, das der Roman gewährt, hat seine Quelle in der Harmonie von Form und Stoff. Updikes Verfahren macht sich eine Grunderkenntnis der Hexenforschung zunutze.
Die Schlüsselwörter sind Legende und Gerücht. Für das legendäre Erzählen ist eine durchgängige Atmosphäre des Wunderbaren charakteristisch, das auf keine externe Beglaubigung angewiesen ist. Alle berichteten Einzelheiten kommen mit derselben Autorität daher; in diesem Kontext gesättigter Alltäglichkeit wirkt nichts unglaubwürdig. Es ist Updikes geschicktester Kunstgriff, dass er der Kunst seiner drei Heldinnen einen bescheidenen Radius zieht. Die Kunststücke fallen zunächst gar nicht weiter auf. Schabernack - beim Empfang nach einem Kirchenkonzert reißt die Perlenkette einer besonders pompösen Hüterin des guten Tons - ist keine Revolution. Der meteorologische Ausnahmezustand, den Alexandra beschwört, weil sie am Strand ungestört ihren Hund spazieren führen möchte, schmiegt sich der Normalität des wechselhaften Wetters der Küstenstadt an.
Als dann bösen Wünschen schauerliche Ereignisse folgen, als Sukies Geliebter seine Ehefrau erschlägt und Jenny, die Konkurrentin der drei Hexen um die Gunst des teuflischen Darryl Van Horne, an Krebs stirbt, bleibt offen, ob die Verwünschungen wirklich ursächlich für die Todesfälle sind. Es gilt allerdings für alle Willensakte, dass ihre Konsequenzen immer auch der Naturkausalität zugeschrieben werden können. Nach einer puritanischen Sündenlehre, die sich auf Jesusworte berufen kann, kommt es auf die Ausführung der bösen Absicht gar nicht an, konstituiert schon der lüsterne Blick oder Gedanke den Ehebruch.
Der Glaube an die Fernwirkung des bösen Denkens schafft seine eigene Realität. Die Magie des berufsmäßigen Zauberkünstlers ist Suggestion, bei der Hexerei mischt sich Autosuggestion hinein. Dass die drei Gespielinnen des reichen Mannes aus New York, der sich mit Labor, Pop-Art-Kollektion und höllisch heißem Schwimmbad im alten Herrenhaus am Ortsrand eingerichtet hat, ihre jüngere Rivalin auf dem Gewissen haben, ist das, was man sich so erzählt und was der Roman weitererzählt. Eine einflussreiche Richtung der Forschung zum Hexenwahn der Frühen Neuzeit führt die diabolische Dynamik der sich fortzeugenden Anschuldigungen auf die Kommunikationsverhältnisse kleiner Gemeinschaften zurück, in denen jeder jeden kennt und das soziale Wissen lokal und mündlich ist.
Die gleiche nur in der Kleinstadt unmittelbar wirksame Macht, die ihre Feinde am Ende einsetzen, um sie aus der Stadt zu vertreiben, üben die Hexen aus. Jeden Donnerstag treten die drei Frauen zusammen, deren Ehemänner sich in Luft aufgelöst haben. Der Sinn des Rituals ist der Austausch von Nachrichten. Dank ihrer wechselnden Geliebten verfügen die Hexen über Informationen aus dem Arkanbereich der anständigen Gesellschaft. Wenn sie über die böse Zunge der Gattin des Chefredakteurs der Lokalzeitung herziehen, ihr Federn und Ungeziefer in den Hals wünschen und das Opfer diese Müllpartikel dann tatsächlich ausspuckt, ist das nur eine gesteigerte Form des Klatsches. Sukie, die jüngste der Hexen, schreibt für die Zeitung, "The Word", eine Klatschkolumne. Die Ehefrauen schließen sich gegen die Geschiedenen zusammen, deren sexuelle Unabhängigkeit für jede bestehende Ehe eine Gefahr darstellt. Im Mikrokosmos des Romans ist die Vermutung der Hexen vollkommen schlüssig, dass die Organisatorinnen der Hexenverfolgung ihrerseits Hexen sind.
Für die sozialkritische Aussage von Updikes Aktualisierung des Neuengland-Topos des Ortsgeistes fanatischer Moralhygiene ist entscheidend, dass er Eastwick nicht als rückständig zeichnet. Nicht zu Unrecht meinen die Bürger, in der "subtilen Provinz" zu leben. Rhode Island stellt Updike als den Staat vor, der seit je theologisch progressiven Häretikern eine Heimstatt bietet. Die Kampagne gegen die Außenseiterinnen geht von Damen aus, die in den guten Sachen des liberalen Engagements das Wort führen. Ihre Kanzel steht in der Kirche der Unitarier - der Konfession, die allen dogmatischen Ballast abgelegt hat und sogar den Teufel als Gastprediger einlädt. Sein Thema: wie schlecht die Schöpfung gemacht ist.
So aufgeklärt ist der Geist von Eastwick, dass der Stadtchronist bis zu der Einsicht vordringt, die Hexen seien eine Ausgeburt der kollektiven Phantasie, des schlechten Gewissens des Gemeinwesens, ihre Kunst ein Produkt derselben beengten Verhältnisse, die anderswo die Gedichte einer Emily Dickinson hervorgebracht hätten. Indem Updike dieses Gemeinschaftsbewusstsein zur Erzählinstanz macht, kann er sich des Urteils enthalten. Wie er spielerisch den Wahrheitsgehalt des Berichts unbestimmt lässt, so bleiben alle Bewertungen der Rationalisierungen der sexuellen Energie, der Urkraft, die Gemeinschaft stiftet und zerstört, ambivalent, relativ zu einem Bewusstsein, das heillos in die Arbeit der Wunscherfüllung verstrickt ist.
Der letzte Roman, den John Updike vollenden konnte, ist sein Wiedersehen mit Eastwick. Die Hexen, die schon im Original, als das dreißigste Lebensjahr hinter ihnen lag, von der Angst vor dem Alter heimgesucht wurden, kehren dreißig Jahre später, nachdem ihnen die Zweitmänner auf natürlichem Wege abhandengekommen sind, an den Ort ihrer Taten beziehungsweise der Gerüchte zurück. Für das System der lokalen Kommunikation, das den Hexen Macht verleiht, indem es sich gegen sie abzuschließen versucht, findet Updike ein frappierendes Bild: "Die Nachricht, das verdammenswerte Trio halte sich wieder in der Stadt auf, sickerte von Ohr zu Ohr wie Regenwasser durch die Gänge einer Ameisenkolonie." Die Eastwicker schrumpfen vor Schreck: Im Ameisenstaat erkennen sie, als sie sich angegriffen wähnen, ihr Ebenbild, in der Diktatur des Konformismus.
Die Verdammungsurteile des Volksempfindens haben jetzt einen deutlich höheren Schwefelanteil - als hätte, seit die Stadt zum Freilichtmuseum mit Wärtern in Vorvätertracht gemacht worden ist, auch der Stadthistoriker sich ins parodistisch überladene Sprachkostüm des gnadenlosen Puritaners zwängen müssen. Mit den alten Zauberformeln lässt sich nicht mehr so viel anrichten wie zu Nixons Zeiten - doch nicht, weil die Gesellschaft repressiver geworden wäre, sondern wohl gerade umgekehrt wegen des Fortschritts der Individualisierung.
Sukie schreibt jetzt Liebesromane. Mit dem Computer hebt sie Textbausteine aus einem Werk ins nächste. So zitiert auch Updike sich selbst. Im neuen Roman überkommt Alexandra beim Gedanken an Jenny die Vision des eigenen Todes, "als ginge rasch die Blende einer gigantischen Kamera auf" - dasselbe Bild, das sich im alten Roman vor das innere Auge der todkranken Jenny schob. Ein Roman sei eine "einfache Wortmaschine", die auf dem Reißbrett entworfen werden könne, hatte der Teufel Sukie eingeflüstert. So hat Updike nie geschrieben. Schöpfung war für ihn nicht Konstruktion, sondern Prozess, er überließ sich der Lust der Sprache. Sein letztes Buch ist ein Spaziergang durch das Vorgängerwerk geworden, dessen Energie ihn, wie er gestanden hat, beim Wiederlesen verblüffte. Nur wer die "Hexen" kennt, sollte die "Witwen" lesen.
Man muss das Buch als Fortschreibung der Legende einordnen. Es antwortet auf Fragen einer elementaren Neugier: Was ist eigentlich aus Alexandra und ihrem Töpfer geworden? Solche Nachträge pflegen sich an Legenden anzulagern, hier hat der Autor selbst das Weiterdichten übernommen. Der Hexer im Bann des eigenen Meisterwerks: den Trick dieses Abgangs macht John Updike keiner nach.
John Updike: "Die Witwen von Eastwick". Roman. Aus dem Englischen von Angela Praesent. Rowohlt Verlag, Reinbek 2009. 414 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main