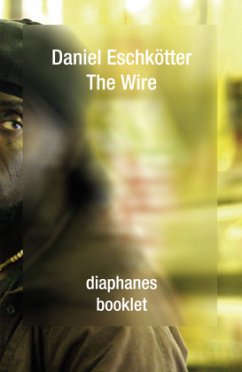Baltimore, Maryland, USA. David Simon, ehemaliger Polizeireporter der »Baltimore Sun«, und Ed Burns, 27 Jahre Polizist und Lehrer in Baltimore, haben die Stadt zur Protagonistin gemacht. Ihre Serie, »The Wire«, das sind 60 Stunden Gesellschaftsanalyse, investigativer und parteiischer Journalismus, Neuerfindung des TV-Krimis. Das Sprechen der Straße und das Versagen der Institutionen, Straßendealer und Drogenbosse, Hafenarbeiter und Mordermittler, Crack-Addicts und Bürgermeister, Schulkinder und Zeitungsveteranen: It's all in the game. It's all in »The Wire«.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Katharina Teutsch nimmt Daniel Eschkötters Analyse der HBO-Fernsehserie "The Wire" zum Anlass für eine weitere Würdigung der auch in deutschen Feuilletons oft gepriesenen Qualitätsserie über einen Lauschangriff der Polizei auf die Drogenszene von Baltimore. Nicht immer ganz klar wird jedoch, ob sie ihre eigenen Gedanken vorträgt, wie weit sie sich auf Eschkötters Thesen stützt oder was sie von dem Buch hält: Immerhin "bestätigt" fühlt sie sich bei dessen Lektüre in ihrem Eindruck, dass die "Meisterschaft" des neuen Qualitätsfernsehens das Fernsehen gewissermaßen rette. Gerade "The Wire" zeige, was das Medium am besten könne: "unvergleichlich dicht erzählen". Gleichzeitig erreicht die Serie mit ihrer minutiösen Schilderung eines medientechnischen Abhörverbunds für die Rezensentin ein bislang nicht gekanntes "Reflexionsniveau" der Serialität im Fernsehen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Das Spiel ist das Spiel, und kein Weg führt hinaus, sondern nur in die nächste Folge: Daniel Eschkötter denkt über den Erfolg der amerikanischen Serie "The Wire" nach
Am Ende sei das alles dann doch irgendwie Fernsehen und kein Roman. Fast beiläufig wird man von Daniel Eschkötter darauf gestoßen, so als müsse man eine Selbstverständlichkeit nachträglich bekräftigen, weil die Kritiker ja nicht aufhören, die sogenannten amerikanischen Qualitätsserien mit dem Gesellschaftsroman des neunzehnten Jahrhunderts zu vergleichen, während sie das Medium Fernsehen selbst für tot erklären.
Was für ein untoter Spuk! Wo ist der Widerspruchsgeist dieses epochalen Leitmassenmediums geblieben? Selbst ein für seine rege Serienproduktion gepriesener amerikanischer Bezahlsender wirbt mit Selbstverleugnung: "It's not television. It's HBO." Es ist vertrackt, wenn man über Serien wie "The Wire", "The Sopranos" oder "Mad Men" einmal nicht als Fan nachdenken möchte, sondern im kühlen Modus der Analyse. Eine bei Diaphanes erschienene Reihe unternimmt jetzt den Versuch, der Eigengesetzlichkeit der Gattung auf essayistische Weise Rechnung zu tragen.
Daniel Eschkötters Lektüre der in Baltimore spielenden und für ihren Realismus gerühmten Polizeiserie "The Wire" bestätigt den Eindruck, mit der modernen Serialität sei vielleicht der Fernseher, nicht jedoch das Fernsehen verschwunden. Denn das nach seiner Erstausstrahlung auf DVD massenhaft konsumierte und via Internet kultivierte Werk finde im Seriellen das Systemische und umgekehrt. In "The Wire" geht es nämlich um einen großen Lauschangriff, mit dem zu einer Sondereinheit zusammengetrommelte Polizisten in den Drogenkrieg ihrer Stadt eingreifen.
Wiretaps heißen die Abhörfallen, mit denen Pager und Mobiltelefone angezapft werden können. Das Netzwerk der Junkies, Dealer, Informanten und Bandenbosse ist also ein genuin mediales. Die kommunikative Beweglichkeit macht den Erfolg der Kriminellen aus. Ihre Drogenlager, Handynummern und Personalien mögen sich ständig ändern. Das Netzwerk bleibt stabil - und das die gesamten sechzig Fernsehstunden, die "The Wire" auf fünf Staffeln verteilt zu bieten hat. "Das soziale Band", schreibt Eschkötter, "ist als konstitutiv mediales zu denken." Folgen wir dieser Aufforderung, erhält die Serie ein Reflexionsniveau, das man dem guten alten Fernsehen gar nicht zugetraut hätte.
McLuhans Diktum vom Medium, das seine eigene Botschaft verkörpere, lässt sich daran jedenfalls bestens belegen. Die Gesellschaft, von der "The Wire" handelt und der auch der darin geschilderte Polizeiapparat angehört, wird erst durch ihre Medien hervorgebracht. Ohne Pager keine Informationskette, ohne Informationskette keine Möglichkeit, diese mit polizeilicher Abhörgewalt zu durchbrechen, und ohne diese Durchbrechung keine dramaturgischen Etappensiege, also keine Zuschauer, die dem Ganzen ihrerseits an ein "Wire" angeschlossen folgen. Die Erzählökonomie der Serie ist somit im Wortsinn ein Drahtseilakt und bleibt genau wie ihre Figuren dem mysteriösen "Wire" unterworfen.
Wo klassische Fernsehserien ihre Zuschauer nach einer vorgegebenen Dauer wieder aus dem Plot entlassen (oder per Cliffhanger hineinholen), saugt "The Wire" sie in ein epistemologisches System, das Form und Inhalt miteinander verschmilzt. Wenn einer der Gangster bemerkt, es sei eben "all in the game", dann ist das fast schon medienphilosophisch zu verstehen. Mit dem "Wire" ist es so ähnlich wie mit dem Internet. Wer darin surft, kann darin umkommen. Halb ist das Ganze nicht zu haben. Merke: Modernes Fernsehen funktioniert als Tautologie: "The game is the game", lehrt uns mit Stringer Bell (er studiert BWL) ausgerechnet der rationalste und damit auch der untauglichste unter den Gangstern.
Die Form mit dem Inhalt verschmelzen: Natürlich tut das auch schon der moderne Großstadtroman. Aber er tut es eben mit anderen erzählerischen Mitteln. Dazu zählten Montagetechniken, wie sie wiederum das experimentelle Kino im zwanzigsten Jahrhundert erprobt hat. Vielleicht ist es deshalb nicht ganz verwegen zu behaupten, mit der modernen "Qualitätsserie" sei eine Kunstform auf den Plan getreten, die sich aus beiden Vorbildern die innovativsten Momente herausgepickt hat, um ein sterbendes Medium zur Meisterschaft zu führen. Erst durch die systemische Geschlossenheit von "The Wire", die scheinbar unbegrenzte Sendedauer der Serie, ihr Eigenleben im Internet und ihre ständige Selbstthematisierung entsteht dieser Sog, der oft zu Vergleichen mit dem Gesellschaftsroman des neunzehnten Jahrhunderts verleitet. Dabei zeigt das Fernsehen mit solchen Produktionen vielleicht zum ersten Mal, was es wirklich kann: wirklich unvergleichlich dicht erzählen.
"Fuckin' A(wesome)!", sagt der zur Überwachung des Telefonverkehrs abbestellte Innendienstler Roland Pryzbylewski, als er das "System" der Gangster mit all seinen Codes, toten Enden und Finten auf einer Schautafel plötzlich als ästhetische Einheit wahrzunehmen beginnt. Totale Künstlichkeit steht also hinter dieser grandiosen Form von Realismus.
KATHARINA TEUTSCH.
Daniel Eschkötter: "The Wire".
diaphanes Verlag, Zürich 2012. 95 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Daniel Eschkötters Lektüre der Polizeiserie bestätigt den Eindruck, mit der modernen Serialität sei vielleicht der Fernseher, nicht jedoch das Fernsehen verschwunden.« Katharina Teutsch, FAZ