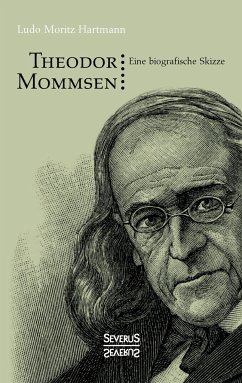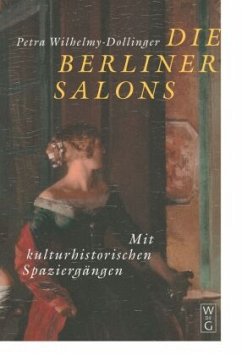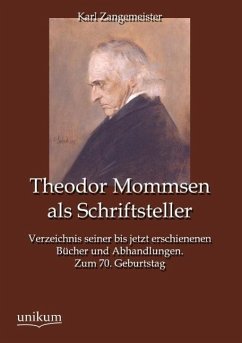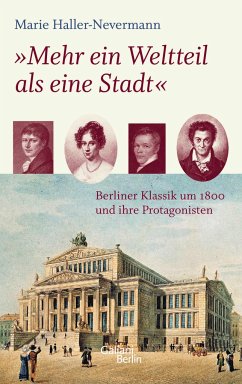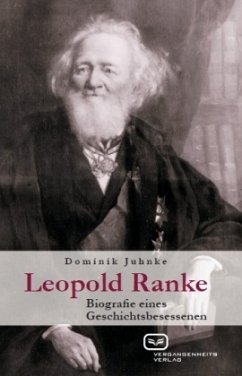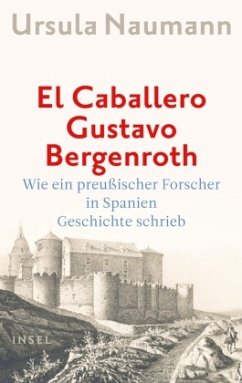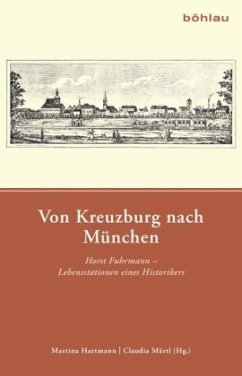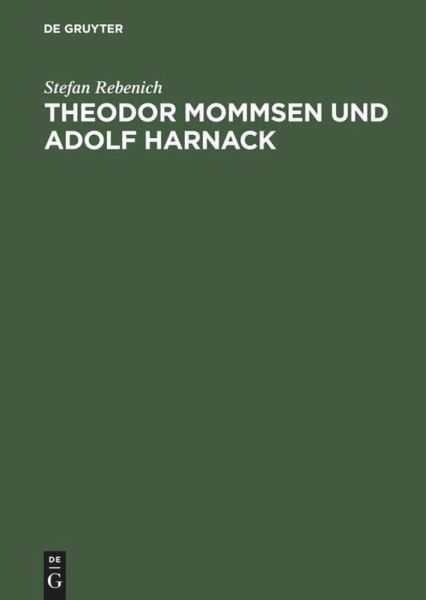
Theodor Mommsen und Adolf Harnack
Wissenschaft und Politik im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Edition und Kommentierung des Briefwechsels

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Keine ausführliche Beschreibung für "Theodor Mommsen und Adolf Harnack" verfügbar.