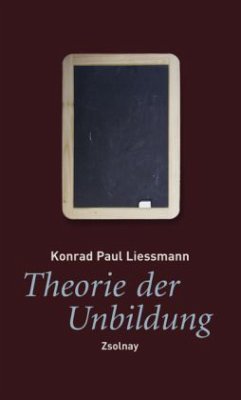Was weiß die Wissensgesellschaft? Wer wird Millionär? Wirklich derjenige, der am meisten weiß? Wissen und Bildung sind, so heißt es, die wichtigsten Ressourcen des rohstoffarmen Europa. Debatten um mangelnde Qualität von Schulen und Studienbedingungen - Stichwort Pisa! - haben dennoch heute die Titelseiten erobert. In seinem hochaktuellen Buch entlarvt der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann vieles, was unter dem Titel Wissensgesellschaft propagiert wird, als rhetorische Geste: Weniger um die Idee von Bildung gehe es dabei, als um handfeste politische und ökonomische Interessen. Eine fesselnde Streitschrift wider den Ungeist der Zeit.

Konrad Paul Liessmann verfertigt eine Theorie der Unbildung
Die Grundthese dieses Buches lautet: Der funkelnde Begriff der Wissensgesellschaft ist gleichbedeutend mit Unbildung. Das ist so, weil der Wissensgesellschaft jede Idee von Bildung fehlt. Beklagt es nicht, begreift es!
Konrad Paul Liessmann ist Professor und Studienprogrammleiter der neugegründeten Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften in Wien. Seit fünfzehn Jahren ist er an der Universität - und ist vor allem mit Universitätsreform beschäftigt gewesen. Das Reformtempo der "Jahrhundertgesetze" war so geschwind, dass es keiner Studentengeneration vergönnt war, ihr Studium unter den Bedingungen abzuschließen, unter denen sie es begonnen hatte. Jetzt hat er zum Rundumschlag ausgeholt: "Theorie der Unbildung". Unbildung - aber wir leben doch in einer "Wissensgesellschaft". Liessmanns Grundthese: Wissensgesellschaft ist Unbildung. Als eine letzte Station auf diesem abschüssigen Weg gilt ihm Theodor W. Adornos Theorie der Halbbildung von 1959. Adorno hatte beklagt, dass humanistische Bildung für Menschen, denen die Muße fehle, sie sich anzueignen, zur Halbbildung werden müsse.
Auf dieses Goldene Zeitalter der Halbbildung schaut der Autor traurig zurück; es war wenigstens normativ auf eine Idee von Bildung bezogen. Wissensgesellschaft sei die Abwesenheit jeder Idee von Bildung. Diese neue Unbildung solle nicht kulturpessimistisch beklagt, sie soll begriffen werden. Einen Wink, in welche Richtung das gehen wird, bekommt der Leser zu Beginn: Unbildung ist weder individuelles Versagen noch verfehlte Bildungspolitik. Sie ist unser aller Schicksal, weil sie die notwendige Konsequenz aus der "Kapitalisierung des Geistes" ist.
Die vermeintlichen alten Antagonisten Kapital und Arbeit ziehen schon lange am selben Strang. Sie haben sich die Herrschaft geteilt. Das Kapital behielt die Macht, seine von ihm induzierte Massengesellschaft dominiert kulturell. Nennen wir sie nach dem Jargon einiger Parteipolitiker die "bildungsfernen Schichten". Auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten wird die Bildung zugeschnitten.
Das Vokabular dieser bildungsfernen Schichten - zugleich Träger der Bildungsreform - ist aufgeblasen, modernistisch und selbstillusionierend. Liessmann zieht gegen sie mit Humboldt und Nietzsche zu Felde. Die "Schule" war für Nietzsche der Ort der Freiheit, befreit von den Bedürfnissen der Lebensnot. Schule kommt aus dem lateinischen schola und aus dem griechischen scholé und bedeutet dem Wortsinn nach das Freisein von (Staats-)Geschäften, da man gelehrte Gespräche führte oder Vorträge hörte. "Eine Schule, die aufgehört hat, ein Ort der Muße, der Konzentration, der Kontemplation zu sein, hat aufgehört, eine Schule zu sein. Sie ist zu einer Stätte der Lebensnot geworden." Letzteres kann man wohl sagen in einem Schulwesen, in dem Lehrer im Ernstfall nur mit Mühe den Attacken der Schüler, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, entrinnen - oder nicht. Liessmann zielt nicht primär auf die Schule, sondern auf die Universität.
Daher weitet er den Abschnitt über die "Pisa"-Studien (Programme for International Student Assessment) zu einer Betrachtung über die Fetischisierung von Ranglisten aus. Inmitten der Demokratie gibt es ein Urvertrauen in Hierarchien, und alles Streben geht dahin, unter die Top Ten zu kommen. Rankings sind nach Ansicht des Autors ein Disziplinierungs- und Kontrollinstrument, um den Universitäten die letzten Freiheiten auszutreiben.
Liessmann veranschaulicht das an den propagierten internen Kontrollen und Evaluationen. "Gerade das Außergewöhnliche, Originelle, Kreative und Innovative, das angeblich in einer Wissensgesellschaft einen so großen Wert darstellt, wird heute durch herkömmliche Evaluationsverfahren prinzipiell ignoriert. Durch Evaluierungen ermittelte ,Exzellenzprojekte' sind schon aus diesen Gründen höchstwahrscheinlich intellektuelles Mittelmaß." Das mag in Österreich so sein, aber nicht nördlich von Kiefersfelden! Positiv wird ein Votum des deutschen Wissenschaftsrates vom 30. Januar 2006 herangezogen, das davor warnt, die Kriterien der anwendungsorientierten Naturwissenschaften den Geisteswissenschaften zu oktroyieren.
Doch auch hierzulande tobt der von den Bildungsministern 1999 beschlossene "Bologna"-Prozess. Uniform wird die Universität auf Bachelor- und Master-Studiengänge und ein dem amerikanischen System nachempfundenes Doktorat zugeschnitten. Liessmann sieht das so: Der Bachelor ist der Studienabschluss für die vormaligen Studienabbrecher. Er unterschätzt dabei, dass jene Leute, denen man früher gesagt hätte: "Sie gehören nicht an eine Universität", heute eben doch studieren. Auch sie brauchen einen Abschluss, und sei es nur, um zur Beruhigung der Bildungspolitiker die Abbrecherquote zu senken. Außerdem sind praktische Köpfe darunter, um deren Fortkommen im Berufsleben man sich kaum Gedanken machen muss. Größere Sorgen bereiten oft jene, die aus Verzweiflung bis zum Master weitermachen.
Da die politische Klasse zunächst und zumeist bildungsfern ist, fällt ihr nichts Besseres ein, als die Prinzipien der Wirtschaft auf alle Bereiche der Gesellschaft zu übertragen. Was der Wirtschaft als Umstrukturierung ins Haus steht, äußert sich auf dem politischen Felde mangels satter Steuereinnahmen als permanente Geldknappheit - und so ist es gekommen, dass der mager gewordene Sozialstaat Sparprogramme als "Reform" verkauft. Daher der Drittmitteleinwerber als der Held der neuen Zeit. Das mag man ironisieren, aber es sind Sachzwänge, denen sich kaum eine der chronisch unterfinanzierten Universitäten entziehen kann.
Es fällt auf, dass in Liessmanns Buch die Studierenden nicht vorkommen. "An dieser Stelle der Jugend gedenkend, rufe ich Land! Land!" (Nietzsche). Es gibt eine Sorte von Studentinnen und Studenten, die es gar nicht geben dürfte. Sie sind gebildet, und die besten von ihnen behandeln Seminarscheine und ECTS-Punkte mit souveräner Verachtung. Was die Bildungsplaner mit ihnen vorhaben, bekümmert sie nicht. Sie haben mit Widrigkeiten genug zu kämpfen. Aber sie lesen Kant und Heidegger oder schreiben kluge Dissertationen über den polnischen Antisemitismus. An dieser Handvoll von Studenten - ich gebe zu, es sind nicht viele - hängt heute die Idee der Bildung.
HEINZ DIETER KITTSTEINER
Konrad Paul Liessmann: "Theorie der Unbildung". Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Paul Zsolny Verlag, Wien 2006. 174 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Heinz Dieter Kittsteiner scheint in weiten Teilen mit der Diagnose Konrad Paul Liessmanns über den Zustand der "Wissensgesellschaft" konform zu gehen. In seiner "Theorie der Unbildung" definiert der Autor "Unbildung" nicht als Verfehlung der Lernenden oder der Bildungspolitik, sondern macht sie als notwendige Konsequenz der Verhältnisse aus. Liessmann ziele vor allem auf die Reformen des Universitätsstudiums ab und sehe in der Einführung von Bachelor- und Master-Abschlüssen oder in Rankinglisten der Universitäten hauptsächlich eine Eindämmung des Besonderen und Außergewöhnlichen, erklärt der Rezensent. Kittsteiner fällt auf, dass in Liessmanns Buch von Studierenden nirgendwo die Rede ist und er fühlt sich deshalb - zur Beruhigung? - aufgerufen, auf eine wenn auch rare Gruppe von Studenten hinzuweisen, die sich ungeachtet jeglicher Hochschulpolitik und -Reformen in der Lektüre ihres Kants und Heideggers nicht beirren lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH