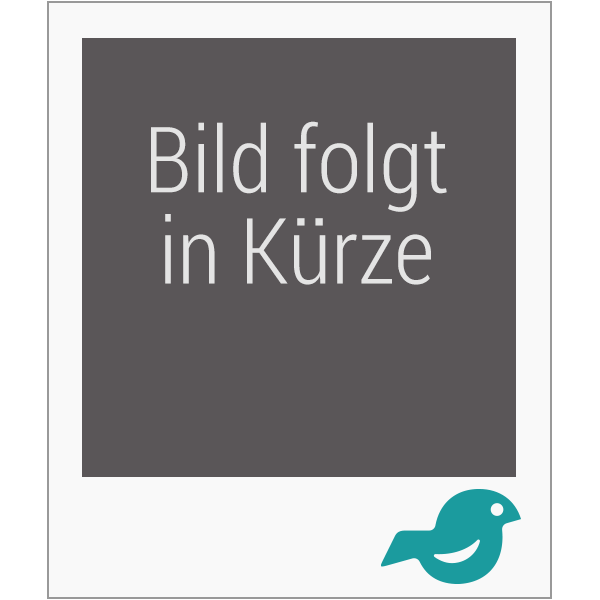Produktdetails
- Verlag: University of California Press
- ISBN-13: 9780520259614
- Artikelnr.: 33611732
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Auf den Spuren von Voltaire, Stendhal und Flaubert: Carlo Ginzburg demonstriert, wie man aus unscheinbaren Details eindrucksvolle Lektüren gewinnt.
Nach seinem Gang ins Exil nach Istanbul gab der Romanist Erich Auerbach 1939 seinem Schüler Martin Hellweg den Rat, "in der Arbeitstechnik nicht vom allgemeinen Problem" auszugehen, "sondern von einem gut und griffig gewählten Einzelphänomen, etwa einer Wortgeschichte oder einer Stelleninterpretation. Das Einzelphänomen kann gar nicht klein und konkret genug sein, und es darf niemals ein von uns oder anderen Gelehrten eingeführter Begriff sein, sondern etwas, was der Gegenstand selbst bietet." Kaum eine Maxime könnte treffender den Ansatzpunkt charakterisieren, den die Essays des italienischen Historikers Carlo Ginzburg wählen. Seit der Veröffentlichung seines berühmten und breit rezipierten Aufsatzes "Spie" - auf Deutsch bislang nur in einer gekürzten Version unter dem Titel "Spurensicherungen" publiziert - haben sich die Arbeiten des prominentesten Vertreters des mikrohistorischen Ansatzes mittlerweile großteils auf das Feld der Arbeiten über das Schreiben von Geschichte verschoben.
Das epistemologische Modell, das Ginzburg 1978 in Anlehnung an Thomas Kuhn als "Indizienparadigma" bezeichnete, geht von bis dahin unbemerkten Details aus, um zwischen scheinbar disparaten Elementen Zusammenhänge zu rekonstruieren. Die Kombination von strengen philologischen Verknüpfungen und gelegentlich spekulativen Thesen kennzeichnet auch Ginzburgs jetzt vorzüglich ins Englische übersetztes Buch: "Threads and Traces. True, False, Fictive" mit fünfzehn Essays aus den Jahren 1984 bis 2009. Der lakonische Untertitel weist bereits auf die epistemologische Problemstellung hin, die sich als roter Faden durch den Band zieht, nämlich die Frage, wie es um das Verhältnis von literarischer Fiktion und historischer Narration bestellt ist.
Damit reagiert Ginzburg vor allem auf das Echo der von Hayden Whites "Metahistory" (1973, dt. 1991) losgetretenen Diskussionen. Viele der vor zwanzig Jahren ausgefochtenen Debatten über die postmoderne Historiographie und ihre politischen Implikationen mögen mittlerweile zwar erledigt sein. Aber dennoch - und darin liegt die anhaltende Aktualität von Ginzburgs hier wieder abgedrucktem, gegen White gerichteten Essay "Just One Witness," bleibt die Frage nach dem Status historischer Realität und ihrer adäquaten Darstellung für den Historiker stets virulent.
Um diese ethisch-praktische Dimension seines historischen Arbeitens deutlich zu machen, bedient sich Ginzburg zweier Strategien: einerseits der konsequenten historisch-philologischen Kontextualisierung der verhandelten Probleme, andererseits einer Technik, die verschiedene Textstränge parallel oder gegeneinander führt und so Verfremdungs- und Überraschungseffekte erzielt. Während die erste Strategie klassisch anmutet - nicht umsonst setzt sie an den wichtigen historiographischen Arbeiten des Althistorikers Arnaldo Momiglianos an -, versteht sich die zweite als experimentell. Sie findet ihre Inspiration nicht nur in der Stilistik Auerbachs, sondern auch bei Autoren wie Italo Calvino oder Raymond Queneau.
Ginzburg gelingen brillante Analysen, vor allem in jenen zentralen Kapiteln, die Lektüren von Montaigne, Voltaire, Stendhal und Flaubert gewidmet sind. So entzündet sich im Fall von Stendhals "Le Rouge et le Noir" eine schwindelerregende Quellenrecherche an einem einzigen beiläufigen Satz, in dem sich der Held Julien Sorel mit dem Aufrührer Israele Bertuccio aus Byrons historischem Drama "Marino Faliero" identifiziert. Wer war dieser "homme du peuple", der sich 1355 der Verschwörung des Dogen Faliero gegen den venezianischen Adel anschloss? Auf wenigen Seiten, die sich wie ein dichter Arbeitsbericht lesen, deckt Ginzburg auf, dass Byron den wahren Namen des Verschwörers (Bertucci Isarello) entstellt und umgekehrt hat.
Ausgehend von diesem philologischen Detail, wird ein historischer Kontext skizziert, in dem die unwahrscheinliche soziale Allianz zwischen dem Plebejer und dem Dogen plausibel erscheint. Doch geht es nicht nur darum, die literarische und anekdotische Entstellung der Figur bei Byron und Stendhal für einen historischen Befund zu verwerten: Die fiktionale Stilisierung revolutionärer Charaktere zeigt noch in der Trivialisierung ihre Kraft. So verweist uns die letzte Fußnote auf den Tagebucheintrag eines jungen Chinesen, der sich mit Stendhals Helden identifiziert, nachdem er die Filmversion des Romans gesehen hat.
In einem anderen Essay setzt sich Ginzburg kritisch mit Auerbachs Lektüre einer berühmten Stelle aus Voltaires "Lettres philosophiques" auseinander, in der die Diversität religiöser Konfessionen im Raum der Londoner Börse ins Lächerliche gezogen wird. Hier finden sich nach dem Muster der russischen Puppen mehrere Lektüren und historische Kontexte ineinander verschachtelt: Eine Skizze der intellektuellen Biographie des exilierten deutschen Romanisten, die dessen zwiespältige Voltaire-Lektüre erhellt, wird mit einer Darstellung der Widersprüche verknüpft, die dem Toleranzgedanken des französischen Aufklärers anhaften. Ginzburg weist Auerbachs Kritik zurück, Voltaires "Scheinwerfertechnik" sei ein der nationalsozialistischen Propaganda verwandtes Mittel, lässt aber auch verstehen, wie Auerbach zu dieser Ansicht kam.
Zweifellos bleiben diese ineinandergeschraubten Lektüren partiell, wie es zwangsläufig der Form des Essays geschuldet ist. Mit ihren Zuspitzungen richten sie den Blick auf weitere, noch zu erschließende Konstellationen, formulieren Anregungen zu größeren, bisher kaum ernsthaft betriebenen Untersuchungen. So könnte man etwa, auf der Spur der Analysen kanonischer Autoren, fragen, welche spezifische Wirkung populären Genres wie dem historischen Roman oder dem Historienfilm zukommt. In solchen Fortführungen der Frage nach den Wechselbeziehungen von Geschichtsschreibung und Fiktion zeigt sich die Herausforderung von Ginzburgs Arbeiten.
ANDREAS MAYER.
Carlo Ginzburg: "Threads and Traces". True, False, Fictive.
Aus dem Italienischen von Anne C. und John Tedeschi. University of California Press, Berkeley 2012. 240 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main