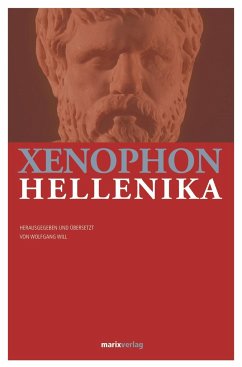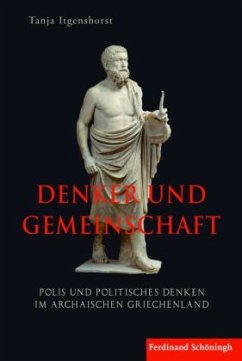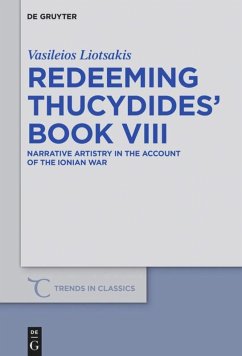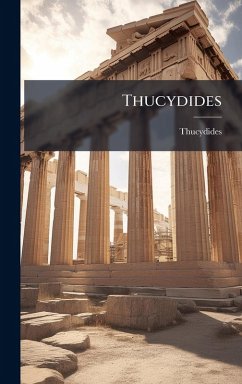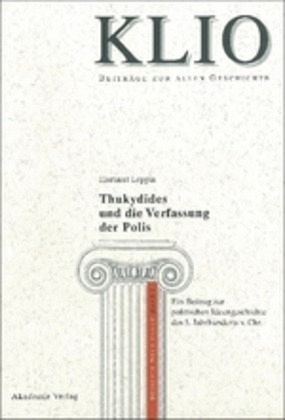
Thukydides und die Verfassung der Polis
Ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte des 5. Jahrhunderts v. Chr.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Thukydides ist zwar einer der meistbehandelten Autoren der Antike, aber an zahlreichen Problemen, die sein politisches Denken berühren, ist die Forschung vorbeigegangen. Eine genaue Untersuchung der Stellung etwa, die er in der von seinen Zeitgenossen lebhaft geführten Debatte über verschiedene Verfassungsformen einnahm, liegt bisher nicht vor. Das politische Denken der Antike findet bis heute auch jenseits der Kreise von Spezialisten intellektuelles Interesse. Im Zentrum der Arbeit von H. Leppin steht ein Text, der zwar kein Dokument expliziter politischer Theoriebildung darstellt, der abe...
Thukydides ist zwar einer der meistbehandelten Autoren der Antike, aber an zahlreichen Problemen, die sein politisches Denken berühren, ist die Forschung vorbeigegangen. Eine genaue Untersuchung der Stellung etwa, die er in der von seinen Zeitgenossen lebhaft geführten Debatte über verschiedene Verfassungsformen einnahm, liegt bisher nicht vor. Das politische Denken der Antike findet bis heute auch jenseits der Kreise von Spezialisten intellektuelles Interesse. Im Zentrum der Arbeit von H. Leppin steht ein Text, der zwar kein Dokument expliziter politischer Theoriebildung darstellt, der aber politische Ideen impliziert: das Geschichtswerk des Thukydides über den peloponnesischen Krieg in 8 Büchern. Es wird keine immanente Interpretation des Thukydides vorgelegt, sondern der Text wird in einen bestimmten Rahmen gestellt, weniger durch den Nachweis quellenmäßiger Abhängigkeiten von anderen Autoren als vor allem durch den Vergleich zeitgenössischer Argumentationsweisen und Begrifflichkeiten. Auf diese Weise wird Thukydides' Position innerhalb der politischen Diskussionen seiner Zeit bestimmt. Mit diesem klassischen Thema der althistorischen Forschung eröffnen wir die Reihe der Klio-Beihefte neu.