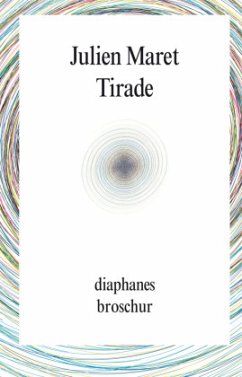Jemand fällt und spricht zugleich, redet, singt, schwadroniert. Seine Lage ist riskant: Es ist ein Ich ohne Geschichte, ohne Zivilstand, das dennoch versucht, mit äußerster Genauigkeit und Intensität dem gerecht zu werden, was ihm zustößt und zugestoßen ist. Im Fallen reihen sich rasende Bilderfluchten eines Lebens aneinander, die in Echtzeit vor unseren Augen vorüberziehen. Und so entsteht die poetische Aneignung eines Lebens, ein parodierter Gesang. Von ferne grüßen, abgrundtief traurig und zum Totlachen, Lewis Carrolls Alice und Samuel Becketts Namenloser. Julien Marets kühnes literarisches Experiment nimmt den Leser von den ersten Sätzen an gefangen: ein bemerkenswerter Romanerstling.

Ein Fall für sich: Julien Marets Romandebüt "Tirade"
Ein Ich-Erzähler, der fällt. Damit beginnt dieser erste Roman des jungen Schweizers Julien Maret, und damit endet er gewissermaßen auch. Dazwischen schillert der Roman inhaltlich in allen Farben. Marets Protagonist ist unzufrieden, er will radikal mit seinem bisherigen Leben brechen. Also wirft er sich in "das Loch", doch im Fallen, wo es nichts gibt außer ihm selbst, wird er immer wieder auf sich selbst und sein Leben zurückgeworfen. Dabei ist das Nichts ebenso Gegenstand der Erzählung wie sein Gegenteil.
In Gedankenexperimenten entführt Maret sich und den Leser in teils streng philosophische, teils völlig freie Überlegungen, die sich schnell in einen Wahn aus Metaphernketten und Neologismen steigern. Dazwischen blitzen immer wieder Erinnerungsfragmente und Gedankenfetzen auf, Ausschnitte aus einem Leben ziehen vorbei, werden reflektiert, dekonstruiert und an anderer Stelle wieder zusammengesetzt. Das Fallen hat keinen Anfang und kein Ende, es bleibt viel Zeit.
All dies bringt der Autor sehr dicht im stream of consciousness aufs Papier; mitunter besteht ein Kapitel aus einem einzigen Satz. Im Rausch von wechselnden Bedeutungen, absoluten Metaphern und assoziativen Elementen innerhalb des Romans verliert sich der Leser geradezu in einem Sturzbach des Bewusstseins und fällt - wie der Protagonist - aus allen Wolken in die Erzählung. Ein Fall auch in die Abgründe semantischer Auflösung, den Grenzen der Sprache entgegen. Die Schwerelosigkeit im Moment des Falls raubt jegliche Orientierung, und die Sprache Marets tut es ihr gleich.
Dennoch erwächst hier aus dieser etwas harten, bausteinartigen Sprache der Schwung einer glatten poetischen Erzählung. Auch der Erzähler weiß: "Ich rotze nicht einfach Wörter durchs Rohr, nein, ich fabriziere reihenweise Gedichte." Unweigerlich denkt man zuweilen nicht nur an Lewis Carroll und Samuel Beckett, wie der Buchrücken verspricht, sondern auch James Joyce und der skurril absurde Witz Italo Calvinos scheinen zwischen den Zeilen auf.
Der Autor, 1978 im Wallis geboren, ist Absolvent des Schweizer Literaturinstituts in Biel. Für diesen ersten, 2011 unter dem französischen Titel "Rengaine" erschienenen Roman wurde er bereits mit dem "Prix d'encouragement de l'Etat du Valais" ausgezeichnet - in der Tat eine Ermutigung durch den Kanton Wallis.
Kaum zu glauben, dass es sich um Erstlingswerk handelt. Inhaltlich klingen fast ausschließlich abstrakte, allgemeine Themen an. Das Fallen zum Beispiel als Zwischenzustand zwischen dem Absprung und dem Aufschlag lässt sämtliche Deutungen zu: das Leben zwischen Geburt und Tod, die Unsicherheit in der Übergangsphase von einem sicheren zu einem anderen sicheren Zustand, chemische Reaktionen. Das ist keine leichte Kost, die sich, mit nur etwas mehr als achtzig Seiten, als Fastfood verzehren ließe. Denn "nichts ist nerviger als die Übergangsphasen".
Und so kann es zu Zwangspausen bei der Lektüre kommen, wenn sich der Text etwa in sich selbst stülpt wie ein Tesserakt im dreidimensionalen Raum oder der Eindruck entsteht, man lese einen Abschnitt, der geschätzte hundert Mal im Google-Übersetzungsprogramm von einer in die nächste Sprache gezwungen wurde, um schließlich mit deutschen Wörtern, aber unterwegs verlorener Grammatik wiederzukehren. Ein Beispiel: "Wie durch ihr behaart besagt in Pflanze Heidekraut Ginster bitter wenig Hang wann Waschbecken aus Dickicht."
Doch kann dies dem Roman nur wenig anhaben, der nicht zuletzt auch durch die erstaunlich wirkungsstarke Übersetzung von Christoph Roeber überzeugt, der mit diesem Werk sicherlich nicht seine einfachste Aufgabe zu lösen hatte. Selbst in den wirrsten Abschnitten bleiben die sinnkonstruierenden Bezüge des Textes erhalten. Die Offenheit und der Sog, der von Marets experimentell aufregender Sprache ausgeht, machen dieses ausgesprochen eigenwillige Buch lesenswert. Es fällt schwer, ein vergleichbares aktuelles Romandebüt zu finden. "Tirade" ist ein Fall für sich.
JONAS HESS
Julien Maret: "Tirade". Roman.
Aus dem Französischen von Christoph Roeber. Diaphanes Verlag, Zürich 2013. 87 S., br., 12,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Staunend, taumelnd und sehr beglückt kommt Jonas Hess nach der Lektüre dieses, was er kaum glauben mag, literarischen Debüts daher - wie passend, dass der Ich-Erzähler in diesem Roman anfangs und zum Ende im Fallen begriffen ist. Ein offenbar sehr dynamisches Buch hat der Rezensent gelesen, der von rigorosen philosophischen Meditationen genauso berichtet wie von völlig freien Sessions, in denen sich die Metaphern überschlagen und überall Neologismen aufblühen: Wahrlich ein dichter stream of consciousness, stellt Hess fest, der sich kopfüber in diesen "Sturzbach des Bewusstseins" stürzt, um sich darin im schwebenden Zustand an Auflösung von Bedeutung und Syntax zu laben. Leicht zu haben ist dieses vielfältig interpretierbare, im übrigen auch hervorragend übersetzte Buch bei aller poetischen Glätte zwar nicht, unterstreicht der Rezensent, doch lohnt es unbedingt, sich diesem offenen sprachlichen Experiment, das gerade nicht auf Beliebigkeit setzt, genussvoll auszuliefern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Julien Maret hat eine Sprache gefunden und sie entgleisen lassen.« Isabelle Rüf, Le Temps