Nicht lieferbar
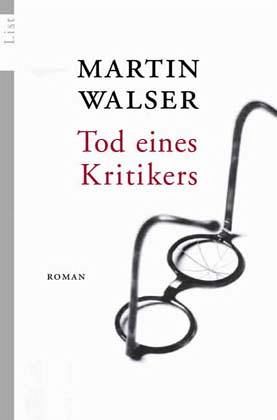
Tod eines Kritikers
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Der Schriftsteller Hans Lach ist verhaftet worden: Mordverdacht. Auf der Party in der Villa seines Verlegers, zu der er ganz gegen die Regeln geladen war, hatte er einen berühmten Kritiker angepöbelt und bedroht, nachdem dieser am selben Abend in der Fernsehsendung 'Sprechstunde' sein neues Buch böse verrissen hatte. Als am nächsten Morgen der gelbe Cashmere-Pullover des Kritikers blutgetränkt gefunden wird, fehlt zwar zunächst noch die Leiche (immerhin war in der Tatnacht ein halber Meter Neuschnee gefallen), aber Zweifel über den Mörder scheint niemand zu hegen. Lediglich Michael Lan...
Der Schriftsteller Hans Lach ist verhaftet worden: Mordverdacht. Auf der Party in der Villa seines Verlegers, zu der er ganz gegen die Regeln geladen war, hatte er einen berühmten Kritiker angepöbelt und bedroht, nachdem dieser am selben Abend in der Fernsehsendung 'Sprechstunde' sein neues Buch böse verrissen hatte. Als am nächsten Morgen der gelbe Cashmere-Pullover des Kritikers blutgetränkt gefunden wird, fehlt zwar zunächst noch die Leiche (immerhin war in der Tatnacht ein halber Meter Neuschnee gefallen), aber Zweifel über den Mörder scheint niemand zu hegen. Lediglich Michael Landolf, ein in München lebender Historiker, spezialisiert auf Mystik, Kabbala, Alchemie und Rosenkreuzertum, schenkt den Vorwürfen gegen seinen Freund keinen Glauben.
Zwei Ermittlungsstränge laufen parallel. Kriminalhauptkommissar Wedekind will die Schuld Lachs beweisen, Landolf dessen Unschuld. Wedekind liest die Bücher des Verhafteten und zieht daraus seine Schlüsse; Landolf befragt Freunde, Kollege
Zwei Ermittlungsstränge laufen parallel. Kriminalhauptkommissar Wedekind will die Schuld Lachs beweisen, Landolf dessen Unschuld. Wedekind liest die Bücher des Verhafteten und zieht daraus seine Schlüsse; Landolf befragt Freunde, Kollege





