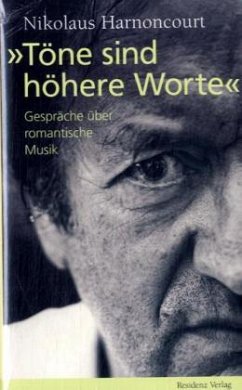BEETHOVEN UND SCHUBERT, VERDI UND JOHANN STRAUSS, Schumann und Dvorak, Brahms und Bruckner, das sind nur einige der Protagonisten dieses Buches, in dem sich Nikolaus Harnoncourt mit den bedeutendsten Werken des Romantischen Jahrhunderts auseinandersetzt. Der Dirigent erzählt darin von seiner lebenslangen Suche nach dem Schlüssel, der dem heutigen Hörer das durch Traditionen und Aufführungsmoden verschüttete Verständnis für die Musik dieser Zeit neu erschließen könnte. Unnachahmlich, mit Überzeugung und Leidenschaft zeigt Nikolaus Harnoncourt, dass unser musikalisches Erbe immer wieder neu gelesen werden muss. Darüber hinaus zeichnet er als Zeitzeuge ein bedrückendes Bild seiner Jugenderfahrungen unter dem NS-Regime und gibt faszinierende Einblicke in das Wiener Musikleben seiner Zeit. In allen Äußerungen Nikolaus Harnoncourts, sei es zur Musik, sei es zu ihrem kulturellen Stellenwert oder zu seinem Selbstverständnis als Interpret, kommt ein Lebensprogramm zum Ausdruck: Musik ist nicht nur ein kostbares Erbe der Vergangenheit, sie muss auch und gerade heute, wie alle Kunst, lebendiger Anspruch auf eine menschenwürdige Zukunft sein.

Fragmente zu einer Theorie musikalischer Hermeneutik: Ein Band versammelt zerstreut publizierte Texte von Nikolaus Harnoncourt.
Von Jan Brachmann
Bezwingend und doch zum Widerspruch reizend war Nikolaus Harnoncourt als Interpret wie als Gesprächspartner und Autor. Er trat als Lehrer und Dirigent mit der Rhetorik des Rigorosen auf, die niederschmetterte, was ihm im Machen und Konsumieren von klassischer Musik verhasst war: Süßlichkeit, geistige Verfettung, "der Glitzerkram der Bequemlichkeit", wie er das einmal nannte. Aber es kam immer wieder vor, dass er aus Einsicht seine radikalen Urteile und interpretatorischen Entscheidungen zurücknahm, dass er seine Ungerechtigkeit bemerkte und sich korrigierte. Auch darin zeigte sich die Größe eines denkend Spielenden und spielend Denkenden, der die Geschichte der musikalischen Interpretation in der Musik zwischen Monteverdi und Beethoven nach 1945 so tiefgreifend verändert hat wie kaum ein Zweiter.
Am 5. März 2016 ist Harnoncourt gestorben, doch seine Wirkung hält an, auch dank seiner Witwe Alice, die seitdem aus dem Nachlass weitere Manuskripte ihres Mannes ediert und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Nach "Wir sind eine Entdeckergemeinschaft" über die Geschichte des Ensembles Concentus Musicus Wien und "Meine Familie", einer Autobiographie der Kinder- und Jugendjahre, kommt nun "Über Musik. Mozart und die Werkzeuge des Affen" heraus. Alice Harnoncourt hat darin Festreden, Vorträge, Vorworte für die Bücher anderer Autoren, Texte für Konzertprogrammhefte und Schallplatten versammelt, die bislang schwer oder gar nicht zugänglich waren, und sie mit wenigen schon veröffentlichten Essays kombiniert.
Sofort schlägt einem - in dem Vortrag "Was ist Wahrheit?" von 1995 - die Wucht eines Denkens entgegen, in dem das Ringen um Erkenntnis immer auch moralische Qualität hatte: "In unserem Jahrhundert hat sich unter den Schlagworten ,Werktreue' und ,Authentizität' eine besonders subtile Art von Verlogenheit etabliert: Zuerst entfernte man die - nun wirklich nicht mehr zeitgemäßen - Retuschen und Änderungen, dann trocknete man - vielleicht in der Reaktion auf die schwülstigen, fast fiebrigen Scheinemotionen der Zeit vor der Jahrhundertwende - die Werke allein auf ihre in Noten festgeschriebene Substanz aus. Man meinte, die Zeilen selbst seien alles, zwischen den Zeilen gebe es nichts als willkürliche Hinzufügungen eitler Interpreten. Je mehr man die Reform zu einer moralischen Angelegenheit machte, desto verlogener geriet sie. Je ,authentischer' man die Werke zu interpretieren behauptete, und dies wahrscheinlich sogar glaubte, desto weiter entfernte man sich vom Eigentlichen, vom Sinn der Musik. Man glaubte das gereinigte Kunstwerk darzustellen und bot in Wahrheit einen ausgedörrten Leichnam."
Das ist starker Tobak aus dem Munde eines Agitators, der sich seit den frühen fünfziger Jahren für die Rekonstruktion alter Instrumente, das Studium alter Spieltechniken und originaler Handschriften starkgemacht hatte, um gegen die Scharlatanerie von Monteverdi-Aufführungen unter Paul Hindemith und die klingende Tortenbüffet-Ästhetik damals gängiger Mozart-Interpretationen Sturm zu laufen. Mit existentieller Verve konstatiert er hier, vierzig Jahre später, wie seine eigenen Impulse zur Masche, zur Mode, zur Marke geworden waren in einem Musikgeschäft, das wiederum Technik und Design von Klängen über Botschaften gestellt hatte.
Nikolaus Harnoncourt war kein Systematiker. Aber seine hier versammelten Texte sind Fragmente zu einer Theorie der musikalischen Hermeneutik, die Grundsätze der philosophischen Hermeneutik, etwa bei Hans-Georg Gadamer, auf das Musikmachen überträgt. "Man kann nicht so tun", schreibt Harnoncourt, "als wäre man ein Mensch aus einer anderen Zeit; das Musikverständnis läßt sich ja nicht vom allgemeinen Denken und Fühlen loslösen. Die Gegenwart wird jede Interpretation und auch deren Aufnahme immer entscheidend mitbestimmen, ob man dies nun wahrhaben will oder nicht." Musikalische Interpretation ist damit nicht Rekonstruktion von Autorenabsichten oder von Hör- und Spielgewohnheiten der Entstehungszeit der Werke, sondern eine vom Interesse der Gegenwart ausgehende Horizontverschmelzung mit dem Anspruch des Werktextes.
Dass wir immer noch angesprochen werden von den Werken, ist - so hätte Gadamer es formuliert - ein Moment von deren Wirkung. Ganz in diesem Sinne setzt Harnoncourt fort: "Wir interessieren uns ja nicht aus oberflächlicher historischer Neugier für diese Werke, sondern weil wir instinktiv empfinden, daß sie uns über die Jahrhunderte hinweg etwas zu sagen haben, was immer aktuell bleibt, und was für uns sehr wichtig ist - gerade, weil uns etwas in unserer Gegenwart zu fehlen scheint."
Was uns fehlt, das ist nach Harnoncourts Meinung die "Logik des Herzens", wie Blaise Pascal es formuliert hatte. Harnoncourt beklagt ein Übergewicht der Technik vor der Ethik und das Vorherrschen einer schrecklich vereinfachten Logik der Folgerichtigkeit. Wir seien, so seine kulturpessimistische Diagnose, gefangen in einem "unsäglichen und krebsartig wachsenden Materialismus", der nichts anderes sei als "die riesenhafte und logische Steigerung der Hilfsmittel, die auch der Affe nützt, wenn er einen Stein zum Knacken der Nuß nimmt".
Man mag Harnoncourt in der Idealisierung alter Zeiten, da Musik in die Mitte des Lebens gehört habe, nicht immer folgen. Und seine These, dass die Mehrstimmigkeit ein Alleinstellungsmerkmal europäischer Musik sei und mit der Komplexität des jüdisch-christlichen Gottesbegriffs zu tun habe, ist mittlerweile ethnologisch widerlegt durch die Entdeckung der wunderbaren Vokalpolyphonie zentralafrikanischer Pygmäenvölker. Aber Harnoncourts Plädoyers für die Wahrheit des Uneindeutigen, für die Fortschrittsresistenz des Mysteriums, für den Mut, Widersprüche aufzudecken und sie auszuhalten, statt sie aufzulösen, reißen mit, weil sie die analytisch argumentierende Vernunft nicht über Bord werfen. Sie sind, in ihrer Kritik am Totalitätsanspruch von Rationalität, selbst wieder eine Form von Aufklärung.
Nikolaus Harnoncourt: "Über Musik". Mozart und die Werkzeuge des Affen.
Hrsg. von Alice Harnoncourt. Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2020. 176 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main