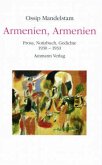Erneut spannt Ferdinand Schmatz den Bogen von dichterischer Innenwelt zu sinnlich wahrnehmbarer Außenwelt: im dreiteiligen "echo" seiner eigenen Dichtung bereist Schmatz die realen Räume zweier Städte und den imaginären Raum der Sprache, deren Zentrum das Gedicht bildet. "tokyo, echo" und "sankt petersburg, echo" sind dabei aber bedeutend mehr als die Summe der bebauten Fläche. Das zufällig aus dem unvorstellbar großen Kontinuum eines Stadt-Bildes Herausgegriffene schlägt um ins Notwendige der poetischen Wahrnehmung und des poetischen Vollzugs. Frei von den Verpflichtungen des Chronisten, der auf die Vollständigkeit der Schilderung setzen muß, schreibt sich Schmatz an die Wurzeln des Wahrnehmbaren, Zeichenhaften und Bedeutenden heran. Während die in Strophen gegliederten Tokyo-Gedichte in ihrer wiederholten Atemlosigkeit und Intensität der stets weiter getriebenen Sprachbewegungen Wirkliches und Vorgestelltes verzahnen, entsprechen die vibrierenden Zweizeiler von "sankt petersburg, echo" im "vor-ruf", "jetzt-ton" und "nach-klang" ganz dem Konzept eines Dichtens von der Mitte her. In diesen Zwischenbereich von Erfindung und Wahrnehmung fügt sich der dritte Abschnitt des Bandes: "dichtung, echo". Schmatz schreibt hier Gedichte mit und entlang der Dichtung anderer. Beginnend an den Scharnieren bedeutsamer Fremdtexte - u.a. von Hölderlin, Kafka, Mandelstam, Busch, Walser - treibt Schmatz seine Gedichte in die Eigenständigkeit, um so die Vorlage dem eigenen Schreiben anzuverwandeln - fernab von postmoderner Zitierwut, in wunderbarem Ton und einleuchtendem Gehalt großer Poesie.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Es kommt doch eher selten vor, dass Rezensenten ihre Ratlosigkeit gestehen oder sogar wie im vorliegenden Fall fragen, ob nicht die "Sprachintensität zeitweise einfach hinter die Linie des einsehbaren Horizonts" steige? Soviel steht für Cornelia Jentzsch fest: Ferdinand Schmatz, frisch gekürter Preisträger des Georg-Trakl-Preises 2004, offeriert seinen Lesern Sprachmaterial, an dem sich selbst berufene Sprachwissenschaftler und -künstler die Zähne ausbeißen könnten. Das liest sich dann so, zitiert Jentzsch: "ohne altar, salär, aber in nöten schwer, anders ein herr (ganz heer)" oder "du schwandest fort um geworden zu sein". Da wird es schwammig, stellt Jentzsch fest, trotz aller Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, diese Beobachtungen mit Wortwitz zu verdichten. Ferdinand Schmatz, in den Fußstapfen der Wiener Gruppe sich bewegend, begreift Sprache als Machtinstrument, erklärt Jentzsch, dem man mit dem Skalpell zu Leibe rücken muss. Doch wer so präzise operiere, müsse sich auch Fragen gefallen lassen, formuliert Jentzsch ihre Einwände: ob denn die Fragmentarisierung der Sprache reiche, um den Erkenntnisgewinn voranzutreiben? Und, fragt sie weiter, müsste es nicht doch eine Ehrfurcht vor dem "Grundsystem Sprache" geben, die deren völlige Zersetzung verhindere?
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH