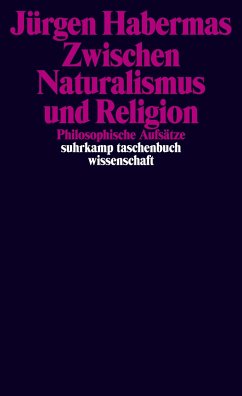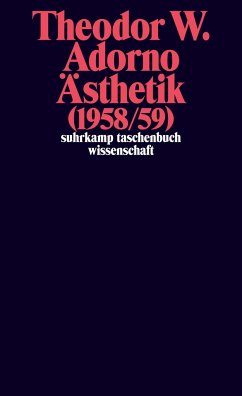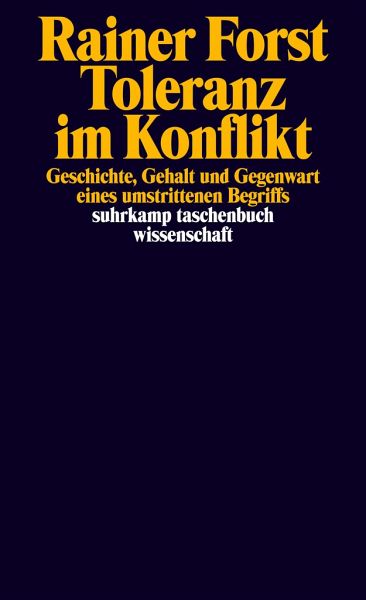
Toleranz im Konflikt
Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
30,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Der Begriff der Toleranz spielt in pluralistischen Gesellschaften eine zentrale Rolle, denn er bezeichnet eine Haltung, die den Widerstreit von Überzeugungen und Praktiken bestehen läßt und zugleich entschärft, indem sie Gründe für ein Miteinander im Konflikt, in weiterhin bestehendem Dissens, aufzeigt. Ein kritischer Blick auf die Geschichte und die Gegenwart des Begriffs macht jedoch deutlich, daß dieser nach wie vor in seinem Gehalt und seiner Bewertung zutiefst umstritten ist und somit selbst im Konflikt steht: Für die einen war und ist Toleranz ein Ausdruck gegenseitigen Respekts...
"Der Begriff der Toleranz spielt in pluralistischen Gesellschaften eine zentrale Rolle, denn er bezeichnet eine Haltung, die den Widerstreit von Überzeugungen und Praktiken bestehen läßt und zugleich entschärft, indem sie Gründe für ein Miteinander im Konflikt, in weiterhin bestehendem Dissens, aufzeigt. Ein kritischer Blick auf die Geschichte und die Gegenwart des Begriffs macht jedoch deutlich, daß dieser nach wie vor in seinem Gehalt und seiner Bewertung zutiefst umstritten ist und somit selbst im Konflikt steht: Für die einen war und ist Toleranz ein Ausdruck gegenseitigen Respekts trotz tiefgreifender Unterschiede, für die anderen eine herablassende, potentiell repressive Einstellung und Praxis. Um diese Konfliktlage zu analysieren, rekonstruiert Rainer Forst in seiner umfassenden Untersuchung den philosophischen und den politischen Diskurs der Toleranz seit der Antike; er zeigt die Vielfalt der Begründungen und der Praktiken der Toleranz von den Kirchenvätern bis in dieGegenwart auf und entwickelt eine historisch informierte, systematische Theorie, die an aktuellen Toleranzkonflikten erprobt wird."