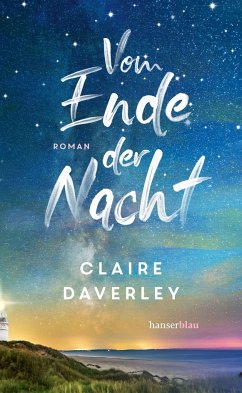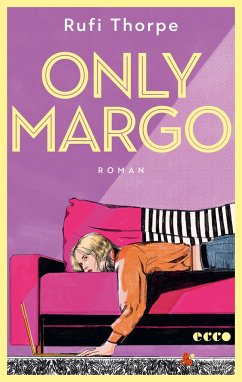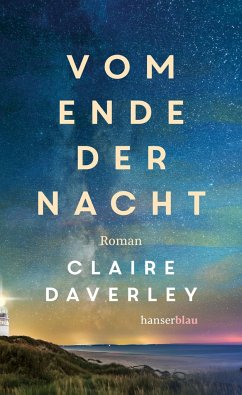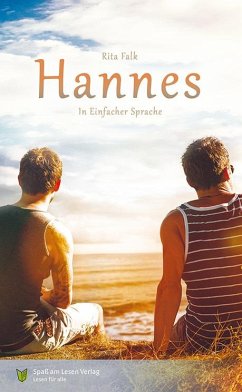Nicht lieferbar

Tony Soprano stirbt nicht
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
In Antonia Baums jüngstem Roman drehte sich alles um drei Kinder, die ständig um das Leben ihres risikoverliebten Vaters fürchten. Nur wenige Wochen vor Erscheinen des Buchs verunglückte Antonia Baums Vater schwer. Wie es sich anfühlt, wenn aus Fiktion Realität wird, und was in einem vorgeht, wenn plötzlich alles stillsteht, die Welt aber weitermacht, davon erzählt sie hier. »Intensivstation, er lag auf der Intensivstation. Tony Soprano, der Gangsterboss aus meiner Lieblingsserie, lag auch schon auf der Intensivstation und wurde wieder gesund. Sein dummer seniler Onkel hatte ihn in de...
In Antonia Baums jüngstem Roman drehte sich alles um drei Kinder, die ständig um das Leben ihres risikoverliebten Vaters fürchten. Nur wenige Wochen vor Erscheinen des Buchs verunglückte Antonia Baums Vater schwer. Wie es sich anfühlt, wenn aus Fiktion Realität wird, und was in einem vorgeht, wenn plötzlich alles stillsteht, die Welt aber weitermacht, davon erzählt sie hier.
»Intensivstation, er lag auf der Intensivstation. Tony Soprano, der Gangsterboss aus meiner Lieblingsserie, lag auch schon auf der Intensivstation und wurde wieder gesund. Sein dummer seniler Onkel hatte ihn in den Bauch geschossen. Seine Familie, Meadow, Anthony Junior, Carmella, sie alle waren sofort gekommen. Wie wir.«
Als Antonia Baum erfährt, dass ihr Vater lebensgefährlich verunglückt im Krankenhaus liegt, ist sie wie gelähmt. Wie kann es sein, dass es den Menschen, mit dem sie noch zwei Tage zuvor im Restaurant gesessen hat, so nicht mehr gibt? Zumindest bringt sie den ohnmächtigen Mann im Krankenbett partout nicht mit ihrem Vater in Verbindung. Hat sie mit ihrem Roman über einen verantwortungslosen, abenteuerlustigen Vater das Schicksal herausgefordert?
In welchem Verhältnis stehen Fiktion und Realität? Ist sie eine Diebin, die ihre wichtigsten Menschen beklaut und aus der Beute Bücher macht? Die Autorin erzählt von Angst, Schuldgefühlen und Tod und davon, warum in ausweglosen Situationen nur Geschichten helfen.
»Intensivstation, er lag auf der Intensivstation. Tony Soprano, der Gangsterboss aus meiner Lieblingsserie, lag auch schon auf der Intensivstation und wurde wieder gesund. Sein dummer seniler Onkel hatte ihn in den Bauch geschossen. Seine Familie, Meadow, Anthony Junior, Carmella, sie alle waren sofort gekommen. Wie wir.«
Als Antonia Baum erfährt, dass ihr Vater lebensgefährlich verunglückt im Krankenhaus liegt, ist sie wie gelähmt. Wie kann es sein, dass es den Menschen, mit dem sie noch zwei Tage zuvor im Restaurant gesessen hat, so nicht mehr gibt? Zumindest bringt sie den ohnmächtigen Mann im Krankenbett partout nicht mit ihrem Vater in Verbindung. Hat sie mit ihrem Roman über einen verantwortungslosen, abenteuerlustigen Vater das Schicksal herausgefordert?
In welchem Verhältnis stehen Fiktion und Realität? Ist sie eine Diebin, die ihre wichtigsten Menschen beklaut und aus der Beute Bücher macht? Die Autorin erzählt von Angst, Schuldgefühlen und Tod und davon, warum in ausweglosen Situationen nur Geschichten helfen.