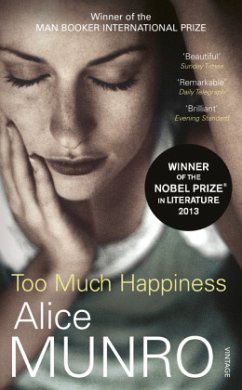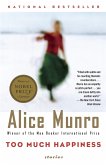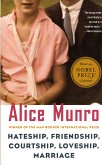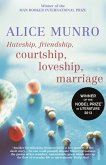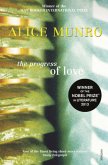Morgen feiert sie ihren achtzigsten Geburtstag: Die auf Geschichten spezialisierte Kanadierin Alice Munro gilt als eine der größten Erzählerinnen unserer Zeit. Aber stimmt das eigentlich?
Von Markus Gasser
Gegen Ende ihres vierunddreißig Jahre kurzen Lebens, als die Tuberkulose in einer abbruchreifen, gefährlich zugigen Villa an der Riviera mit geduldiger Perfidie ihre Lungen zerfraß, wollte die neuseeländische Kurzgeschichtenautorin Katherine Mansfield einen Fächer aus schwarzer Spitze auf ihrem Nachttisch plaziert wissen, einen geladenen Revolver und ein Buch.
Unzählige Autoren der Gegenwart würden, in Mansfields Lage geraten, die Erzählungen von Alice Munro griffbereit halten: Glaubt man Margaret Atwood, A.S. Byatt, Richard Ford, Jonathan Franzen, Lorrie Moore bis Annie Proulx, dann muss sich jeder an Munro messen, der auch nur auf die Idee verfallen sollte, sich ans Erzählen zu machen, und würde sie heute jeden Preis entgegennehmen, den man ihr anträgt - lediglich der nobelste steht noch aus -, wäre sie das ganze Jahr über rund um die Erde unterwegs.
Munros Namen sprechen kennerschaftsbeflissene Leser hier ehrerbietig flüsternd, dort donnernd triumphal oft zum Schluss einer eben ausgestanden geglaubten Literaturdebatte aus: "Alice Munro! Das ist Kunst!" Besonders berufszerquälte Schriftsteller schwören auf sie, als hätte "Munro" die Wirkungsmacht eines Bannspruchs gegen die Harpyien der Schreibblockade. Wie denn auch anders? Nach der Vorgabe, es ließe sich jede Geschichte besser, knapper und überhaupt alles noch und noch einmal anders fassen, arbeitet Munro mit altbiblischer Strenge bis zu einem Jahr an nur einer Erzählung, die grundsätzlich nie die Fünfunddreißig-Seiten-Schwelle überschreitet. So wurde sie "unser Tschechow", die "universale Kanadierin", gar ein "kosmisches Wunder", nachahmenswert unnachahmlich.
Seltsam: Viel mehr als solch ein in alle Literaturhimmel emportragender Applaus fällt zu Munro niemandem ein. Superlative sind immer verdächtig, und jene, mit denen man sie seit jeher behängt hat wie einen Weihnachtsbaum, logen sich darüber hinweg, wie beschwert von den Moden der Zeit die Enge ihrer ersten rund vierzig Selbstfindungsfabeln war. Sah man genauer hin, schien man sich fast notgedrungen mit totgeredeten Formeln begnügen zu müssen, die nur wenige als Warnungen zu lesen verstanden, "Geschichten wie das Leben selbst", "von sparsamer Genauigkeit", "filigran", "lakonisch", "schonungslos" - und einmal ereilte sie, unvermeidlich, auch jene Lieblingssentenz der meisten Kritiker, Munro schildere - "eindringlich", versteht sich, "und präzise" - das Scheitern des amerikanischen Traums, obwohl keine ihrer short stories je in den Vereinigten Staaten angesiedelt war. Das fiel schon gar nicht mehr auf und war auch einerlei. Andernorts nämlich hatte sich längst Unheimliches ereignet.
Ein Jahr vor Munros Erzählbanddebüt "Tanz der seligen Geister" 1968 war mit "Hundert Jahre Einsamkeit" von Gabriel García Márquez das Abenteuer in die Literaturgeschichte heimgekehrt, und die fing nunmehr mit einer derart wuchtigen Schöpfungsautorität von vorne an, als könnte ein Schriftsteller Fische allein durch Nennung ihres Namens aus dem Meer hervorholen, das bei Munro vorab erschöpft wirkte, mürrisch und grau und ewig auf Ebbe gestimmt. Übernächtig und sonnenscheu, verkrochen sich ihre Erzählungen in die Schattenseiten des Daseins, in die ratlose Verrätselungsmanie der Gattung Kurzgeschichte und den insgeheim allseits gefürchteten "offenen Schluss". Denn Munro misstraute der Literatur, für sie eine Nummernrevue billiger Tricks, von Grund auf - und vielleicht hatte sie tatsächlich, dachte sie oft, nur mit dem Schreiben begonnen, weil sie nach der Lektüre der "Sturmhöhe" entschlossen war, Schriftstellerin werden zu wollen. Doch kein noch so fahl flackerndes Fünkchen war von ihrer Teenagererleuchtung Emily Brontë geblieben: "Das Leben der Menschen", umriss sie damals verdrossen ihren Erzählhorizont, sei "flau, einfach, wunderlich und unergründlich" - als besagte das was und gälte für jeden, als käme man nicht von einer kaum verkraftbaren Bedeutungsfülle, von Homer, der Bibel, Shakespeare, Nabokov und Herman Melville umgeben zur Welt. Noch galt das Unvermögen, einen Plot zu ersinnen, als eine Kühnheit wie jenes Musikstück von John Cage, das sich in Stille erschöpfte und keines mehr war.
So handlungsarm überraschungslos und trübe, wusste Munro, ging es nicht weiter - es würde ja auch niemand russisches Roulette mit leerem Magazin allen Ernstes für ein Wagnis halten. Anfang der siebziger Jahre hatte sie ihre "Weltreise aus dem Eheheim" und der unentwegten Verstellung begonnen und aufgehört, sich bei Männern in Sicherheit zu bringen, um im parfümierten "Morast des Animalischen" zu versinken - so ihre ungewohnt drastische Wendung für den Zwang zu Heirat und Mutterschaft. Und seit dem leider noch immer unübersetzten "Tell Me Yes or No" 1974 traten plötzlich ein ums andere Mal Munros Wunderwerke ans Licht: von der ihr nun eigenen, überfallsartigen Dynamik getrieben, mit der im abrupten Zeitsprung eine nachgetragene Episode die Draperien des Gewöhnlichen zerreißt und sich zuletzt oft ins Gespenstische weitet. Sie fanden, versammelt in den Bänden "Das Bettlermädchen" und "Offene Geheimnisse", um die Jahrtausendwende in "The Bear Came Over the Mountain" ("Der Bär kletterte über den Berg") ihren Höhepunkt, der unbestreitbar schönsten Liebesgeschichte der Welt über jenes Paar, das auch die Alzheimerkrankheit nicht zu trennen vermag. Man könnte sich seine Freunde danach aussuchen: Wem am Ende dieser Erzählung die Tränen gekommen sind, während ein breites Lächeln sein Gesicht erhellt, der kann kein schlechter Mensch sein.
Alice Munro bewies damit den Lehrsatz des argentinischen Pointierungsexperten Jorge Luis Borges, was für ein Unsinn es doch sei, auf fünfhundert Seiten einen Gedanken auszuwalzen, dessen mündliche Darlegung nur wenige Minuten in Anspruch nähme. In sich vollkommen, großherzig und nicht selten selbst einem Tschechow überlegen, geriet beinah jede Kurzgeschichte zu einem Roman noir im Kleinformat. Da mochte sie ihre Arbeit - acht Tage die Woche, oft nahe am Herzstillstand - bisweilen als eine verfeinerte Form von Kreuzigung empfinden: Ihre Leser überkam das Gefühl, das Universum sei an einem einzigen, mauritiusblau strahlenden Sonntag leicht- und wie nebenhin erschaffen worden nur zu dem Zweck, damit Alice Munro darin schreiben konnte. Aber es sollte noch verwegener kommen.
Ein prahlerisch verrückter Exhippie tötet seine Kinder, und seine Frau tröstet sich kraft seiner Wahnvorstellung, er hätte die drei wohlauf im Himmel gesehen, so weit darüber hinweg, dass sie bei einem Verkehrsunfall geistesgegenwärtig Leben retten und einen Sterbenden "an seine Pflicht zum Atmen" erinnern kann; eine Studentin rächt sich an ihrer Kommilitonin, die sie offenen Auges in den unterkellerten Betonbau eines sarkastischen Altpädophilen laufen lässt, wo sie ihm nackt - aber nicht befriedigend genug (ihre Brüste sind, unknabenhaft, zu groß) - Gedichte vorzulesen hat; zwei Mädchen ertränken ein drittes, von dem sich das eine der beiden erotisch verfolgt und angezogen fühlt zugleich - und prompt warf die Kritik Munros letztem und brillantestem Band "Too Much Happiness" 2009 die fahrlässige Nutzung von pulp fiction vor.
Gemeint waren damit jene haarsträubenden Reißer um sex and crime, wie sie im Boulevard und - leicht zu vergessen - in den größten Tragödien zu finden sind, und tatsächlich ging es bei Munro noch nie so scheinheilig gelassen im Anfang, so melodramatisch dann und fast heiter gewalttätig, selbstreflektiert durchtrieben und beklemmend abseitig zu wie in diesem Buch. Es türmt sich gleich einem Massiv für Extrembergsteiger für Literatur vor uns auf: "Zu viel Glück" ist von einer derart unnachgiebigen existentiellen Spannung und Komplexität, dass mehr als eine der zehn Erzählungen pro Tag zu lesen sich kaum verkraften lässt. Wie zum letzten Akt geht sie aufs Ganze: Munro ist, sagt sie, in ein Alter eingetreten, da sie auf dem Kreuzweg der eigenen Gebrechlichkeit stündlich mit dem Tod zu rechnen hat wie mit einem Fremden draußen vor der Fliegengittertür. Und so steht im Herzen des Bandes auch plötzlich ein nervöser Psychopath im Flur einer betagten Witwe, der gerade seine gesamte Familie erschossen hat.
"Ich habe das Gleiche getan wie Sie" - Nita erzählt dem Eindringling, sie hätte einst die Geliebte ihres verstorbenen Mannes Rich vergiftet. Dabei war in Wahrheit sie die Geliebte, die Rich einer anderen abspenstig machte und die sich nun - passionierte Leserin, die sie ist - in Richs betrogene erste Frau wie in eine Romanfigur hineinversetzt, um ihr krebsversehrtes Leben zu retten. Mit dieser Liebeserklärung an die Literatur und dem Entsetzen darüber, dass das Glück des einen oft aus dem Unglück des anderen erwächst, ist Alice Munro schon vorweg über ihre etwaigen Nachfolger hinaus. "Es wundert mich zuweilen", schreibt sie einmal, "wie alt ich bin." Uns auch.
Alice Munro: "Zu viel Glück". Zehn Erzählungen.
Aus dem Englischen von Heidi Zernig. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. 365 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
She writes with a beautiful clarity, an elemental humanity and a marvellous, limpid, funny, apprehension of what goes on Jane Shilling Sunday Telegraph