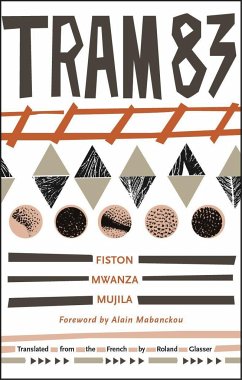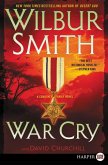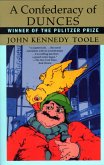Er kommt aus Kongo, schreibt auf Französisch und unterrichtet in Österreich: Zu dem, was man mit Sprachen machen kann, hat Fiston Mwanza Mujila seine eigene Theorie.
Von Florian Balke
Er stammt aus der letzten französischsprachigen Stadt Afrikas. So nennt Fiston Mwanza Mujila seine Heimat Lubumbashi, die Millionenstadt, in der er 1981 zur Welt kam. Die Hauptstadt der alten Minenprovinz Katanga liegt ganz im Süden Kongos. Mit dem Bus, sagt der in Graz lebende Schriftsteller, braucht man über die naheliegende Grenze zu Sambia, dem ersten der englischsprachigen Nachbarländer, nur eine Stunde. Das portugiesischsprachige Angola ist in zwei Tagen zu erreichen. Nach Kinshasa hingegen, in die Hauptstadt seines eigenen Landes, gibt es quer durch den Urwald keine durchgehende Straßenverbindung. Wer nicht das Geld für einen teuren Flug hat, ist mit Auto, Zug, Bus und Schiff manchmal drei Monate unterwegs.
Lubumbashi ist eine Minenstadt, Kongo ein Rohstoffland. Coltan wird abgebaut, veredelt zu Tantal ist es ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Smartphones. "Kongo ist Teil der Weltwirtschaft", sagt Mwanza Mujila ironisch. "Tram 83", sein Debütroman, den er demnächst auf den "Frankfurter Literaturtagen" vorstellt (siehe Kasten), schildert die Gesellschaft, die sich in der wildesten Bar einer typischen Minenstadt versammelt. Hier wird das Geld ausgegeben, dass von der Wertschöpfungskette ausländischer Minenkonzerne für schwarze Arbeiter und bestechliche Offizielle abfällt, hier schaut der "abtrünnige General" vorbei, ein Lokalherrscher, wie es ihn in Kongo, dessen zunehmend autoritäre Zentralregierung über weite Teile des Ostens keine Macht hat, sehr oft gibt. Hier sucht eine Arbeitergesellschaft, geprägt von Männlichkeitsidealen und latenter Gewalt, bei den "Küken" in den Hinterzimmern nach Entspannung vom Alltag, drumherum finden sich Künstler und Gauner wie der Schriftsteller Lucien und der Dieb Requiem.
Ein wenig Lubumbashi steckt auch im Buch, das nicht von einer bestimmten Stadt und einem bestimmten Land, sondern von allen Minenstädten der Welt erzählt, wie Mwanza Mujila sagt. Geschrieben hat er das Buch, seinen ersten Roman nach mehreren Gedichtbänden, allerdings in Europa: "Ich wollte als Schriftsteller leben." Das ist zu Hause schwer. In Lubumbashi hat er Literatur studiert, dort wird harte Arbeit bewundert, Aufmerksamkeit für Autoren aber gibt es kaum. Mwanza Mujila hat in Belgien, Deutschland und Frankreich gelebt und wohnt seit einiger Zeit in Graz, wo er an der Universität afrikanische Literatur, Kunst, Film und Geschichte unterrichtet. Die Stadt ist für ihn zur Heimat geworden: "Ich bin viel unterwegs, aber ich kann nur hier schreiben."
"Tram 83" hat er Anfang 2014 rasch verfasst. Das von seiner Liebe zur Musik durchtränkte Buch, das von den Träumen und Alpträumen nicht nur der kongolesischen Gesellschaft erzählt, ist vor zwei Jahren im französischen Original erschienen und stand voriges Jahr auf der Longlist der internationalen Ausgabe des Man-Booker-Preises. Vor wenigen Monaten ist es bei Zsolnay in Wien auch auf Deutsch herausgekommen. Angelegt hat es Mwanza Mujila, der mit dem Schreiben begann, obwohl er Musiker werden wollte, dann aber an der Musikschule von Lubumbashi und in der ganzen Stadt kein Saxophon zum Üben fand, wie ein Jazzkonzert von Heinz Sauer und Michael Wollny - jeder Moment ein eigener Klang, ganz anders als der Augenblick zuvor oder der danach: "Sprache ist wie ein Instrument", sagt der Autor, für den einzelne Passagen eines Textes durch Satzbau, Wortwahl und Lautinstrumentierung so verschieden klingen können wie das geliebte Saxophon, eine Flöte oder ein Vibraphon.
Das Buch, das zwischendurch auch in die Folterkeller führt, zeigt einen Erzähler, der den Dichter nicht vergessen hat. Seine für alle anderen Minenstädte stehende Stadt der Gier, des Genusses, der Freude und der Verzweiflung aber beschreibt auch die Wirklichkeit Kongos. Denn von einem ist Mwanza Mujila überzeugt: "Kongo ist keine postkoloniale Gesellschaft, sondern eine koloniale." Noch immer gehören die Minen in Katanga und anderswo großen Konzernen aus den einstigen Kolonialstaaten: "Vor der Kolonialzeit gab es keine." Insofern ist sein oft fast allegorisch angelegtes Buch für ihn auch ein sehr konkretes "Nachdenken über die Globalisierung". Geschrieben ist es mit einem scharfen Blick auf das, was sich in der Lebenswirklichkeit seines Landes abspielt, zugleich aber stets literarisch gedacht: "Ich versuche, zuallererst Schriftsteller zu sein und erst dann Kongolese." Als Bürger seines Landes könne man derzeit gar nicht anders, als sich politisch zu engagieren. Das jedoch tue Büchern nicht gut. Literatur müsse politisch sein, aber vor allem sie selbst bleiben. Und eine allzu deutliche Kritik an der immer diktatorischer auftretenden Regierung des Präsidenten Joseph Kabila empfehle sich ebenfalls nicht: "Man muss viele Metaphern benutzen."
Man selbst bleiben. Dass das auch möglich ist, indem man sich verändert und wächst, hat Mwanza Mujila an seinem eigenen Leben erfahren. Schriftsteller, sagt er, habe er in Lubumbashi nur durch seine Eltern werden können. Sein Vater besaß zu Hause eine kleine Bibliothek, seine Mutter legte Wert darauf, dass der Sohn die öffentliche Bücherei benutzte, und schenkte ihm Bücher. Um ihm eine gute Ausbildung und eine bessere Zukunft zu ermöglichen, beschlossen die Eltern darüber hinaus, mit ihm zu Hause Französisch zu sprechen, draußen vor der Tür des elterlichen Heimes die Hauptamtssprache des Landes. Mit seiner Mutter spricht Mwanza Mujila seitdem Suaheli, mit dem Vater Französisch: "Bis heute."
Da er nebenher auch noch Tschiluba beherrscht, die Sprache seiner Großeltern aus der Nachbarregion Kasai, und die fast im gesamten Kongo verbreitete Handelssprache Lingala pflegt, die er lernte, weil sie für ein paar von ihm bewunderte Musiker von Bedeutung ist, hat ihn in Österreich auch das Deutsche nicht erschreckt: "Die Sprachen leben im Kopf zusammen." Anders als die Mehrzahl der in Frankreich schreibenden afrikanischen, karibischen und asiatischen Kollegen, die er auf den "Literaturtagen" treffen wird, spricht er im Alltag inzwischen Deutsch und benutzt Französisch nur als Arbeitssprache: "Ich habe zwei Leben, eines in der Frankophonie und eines in der deutschen Sprache." Er liest viel österreichische Literatur und genießt es, sich eine weitere literarische Ahnenreihe geben zu können. Mittlerweile stehe er nicht mehr nur in der Tradition von Camus oder Apollinaire, sondern auch in der Ernst Jandls und Friederike Mayröckers: "Man wird ein zweites Mal geboren."
Und während er mit den anderen Teilnehmern der "Literaturtage" die lebhafte französische Debatte darüber weiterführen kann, ob das Publizieren in der auf die Standardsprache fixierten Frankophonie für Autoren aus den einstigen Kolonien gut oder hinderlich ist, freut er sich über sein neues deutsches sprachliches Spielzeug. Ein Kind, sagt Mwanza Mujila, könne mit allem spielen. So besäßen auch alle Wörter sämtlicher Sprachen ihre eigene Poesie. Da ist das Wanderleben das beste Spielzimmer: "Ich bin wie ein Kind."
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main