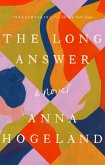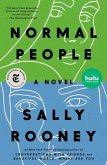National Bestseller . A Finalist for the Scotiabank Giller Prize . A Finalist for the Goldsmiths Prize . Long-listed for the International Dublin Literary Award . One of Time Magazine's Top 10 Fiction Books of the Year A New York Times Book Review Notable Book . Named a Best Book of the Year by The Guardian, Southern Living, NOW Magazine, Commonweal, The Washington Independent Review of Books, the San Francisco Chronicle, The Globe and Mail, BOMB Magazine, and The National Post (Canada) The Stunning Second Novel of a Trilogy That Began with Outline, One of New York Times Book Review's 10 Best Books of the Year In the wake of her family's collapse, a writer and her two young sons move to London. The process of this upheaval is the catalyst for a number of transitions-personal, moral, artistic, and practical-as she endeavors to construct a new reality for herself and her children. In the city, she is made to confront aspects of living that she has, until now, avoided, and to consider questions of vulnerability and power, death and renewal, in what becomes her struggle to reattach herself to, and believe in, life. Filtered through the impersonal gaze of its keenly intelligent protagonist, Transit sees Rachel Cusk delve deeper into the themes first raised in her critically acclaimed novel Outline and offers up a penetrating and moving reflection on childhood and fate, the value of suffering, the moral problems of personal responsibility, and the mystery of change. In this second book of a precise and short yet epic cycle, Cusk describes the most elemental experiences, the liminal qualities of life. She captures with unsettling restraint and honesty the longing to both inhabit and flee one's life, and the wrenching ambivalence animating our desire to feel real.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Ehe hält nicht etwa zwei Menschen zusammen, sie bedeutet die Verleugnung gewisser Wirklichkeiten: Rachel Cusk hantiert mit schematischem Romanpersonal.
Sie ist Schriftstellerin. Sie ist geschieden. Sie hat zwei Kinder, die gerade nicht bei ihr sind. Sie unterrichtet kreatives Schreiben, manchmal. Faye heißt sie, die Erzählerin in dem Roman "Transit" von Rachel Cusk, doch ihr Name wird nur einmal genannt, geradeso wie in dem im vergangenen Jahr auf Deutsch herausgekommenen Vorgängerroman "Outline" (F.A.Z. vom 10. Mai 2016).
Es handelt sich, so heißt es, bei "Transit" um den zweiten Teil einer geplanten Trilogie. Das ist für ein Buch eine schwierige Position, und möglicherweise liegt es auch daran, dass "Transit" nicht die Zwangsläufigkeit erreicht, die "Outline" hatte - ein Roman übrigens, der sehr gut für sich allein stehen kann.
Auch "Transit" ist erst einmal als selbständiges Buch zu lesen. Die Ich-Erzählerin zieht vom Land zurück nach London. Die Wohnung, die sie in einem heruntergekommenen Haus gekauft hat, in dessen Untergeschoss eine bösartige Familie lebt, muss renoviert werden, was ebenso Zeichen wie weiterer Anlass der Unbehaustheit der Figur ist. Das Leben dieser Frau ist auseinandergebrochen, und aus Fragmenten, Beobachtungen und Gedanken zum Leben anderer scheint sie sich das Gerüst für ein neues basteln zu wollen, obwohl sie in "Transit" eher abwartet als aufbaut. In jedem Kapitel geht es um eine Begegnung, die philosophische Überlegungen in Gang setzt oder Fragen aufwirft. Fragen, die sowohl aufs Leben wie aufs Schreiben zielen. Hier wie dort geht es um die Illusion - die Illusion eines gelungenen Lebens oder überhaupt der Möglichkeit dazu auf der einen Seite, auf der anderen um die Illusion von Wirklichkeit, die Literatur oder zumindest schöne Sätze erzeugen.
Für beides hat Rachel Cusk offenbar keine Verwendung (mehr), ebenso wenig wie ihre Erzählerin: "Ich sagte ihm, meiner Ansicht nach funktionierten die meisten Ehen so, wie man es von einer Geschichte erwarten würde: Man müsse sich einfach auf eine Fiktion einlassen. Es sei nicht Perfektion, die zwei Menschen zusammenhalte, sondern die Verleugnung gewisser Wirklichkeiten."
Sich nicht mehr auf eine Fiktion einzulassen, das bedeutet, autobiographisch zu erzählen, dies aber im vorliegenden Fall, ohne die zentrale Figur, die da erzählt, plastisch werden zu lassen. Eine reizvolle Aufgabe, aber auch riskant. Schnell wird klar, wir lesen kein Buch, das uns für sich, seine Figuren, gar die Autorin einnehmen will, sondern wir lesen ein Buch, das ein Experiment ist: Wie und was lässt sich erzählen, wenn die Figur, die spricht, schemenhaft bleibt? Wenn die Menschen, die sie trifft, fast sämtlich uninteressante Gestalten sind, die Situationen banal, etwa der Empfang einer Spam-Mail, ein Abendessen, ein Friseurbesuch? Und wenn die Sprache, in der das alles häufig in indirekter Rede berichtet wird, flach bleibt, obwohl Rachel Cusk durchaus Sätze schreiben kann, die nicht auf der Seite kleben bleiben? Womit hält uns ein solches Buch bei der Stange? "Transit" gelingt es nur bedingt. "Ist doch seltsam", sagt der ehemalige Freund der Erzählerin, als sie sich zufällig Jahrzehnte nach ihrer Trennung wiedertreffen, "dass du ständig alles verändert hast und ich nichts und wir trotzdem am selben Ort gelandet sind." Die Erzählerin, die daraufhin nichts sagt, scheint sich mit der Autorin zu fragen: ist das Schicksal? Oder Zufall? Aber als Leserin denkt man: Spielt es eine Rolle, und wenn ja, wofür?
Das Buch beginnt damit, dass die Erzählerin die Mail einer Astrologin bekommt mit der Nachricht, in ihrem "persönlichen Himmel" kündige sich "ein wichtiger Transit" an. Ihr ist völlig klar, dass die Mail von einem Computerprogramm abgeschickt wurde, vermutlich vom selben generiert wie die Astrologin selbst. Die Erzählerin empfindet die Mail einerseits als bedrohlich, andererseits erinnert sie das Schreiben an einen depressiven Freund, der sich in der direkten Ansprache von Werbung oder von der Stimme des Navis im Auto fürsorglich, sogar liebevoll angesprochen und ernst genommen fühlte. Diese Überlegungen, verbunden mit dem Bericht des Wohnungskaufs in London, bilden den Prolog. Auf die Wohnung kommt das Buch zurück. Auf das Horoskop auch. Auf den Freund nicht und auch nicht auf die Frage, was es bedeutet, wenn die tote Ansprache eines Werbeposters oder die digital erzeugte Stimme aus einem Gerät uns Trost spenden.
Auch jedes der folgenden Kapitel steht für sich, das bedeutet, in jedem wird in gewisser Weise einer Frage (oder auch mehreren) nachgegangen, eine Begegnung geschildert. Die Begegnung mit zwei anderen Autoren etwa auf einem Literaturfestival in einem der lustigeren Kapitel. Einer heißt Julian, ist "groß und fleischig", elegant gekleidet und übernimmt die Rolle des Anheizers, obwohl ein Moderator da ist. Julian, ein Exemplar von Traditionalismus, hat ein autobiographisches Buch geschrieben, aus dem er liest. "Die Leser glaubten, dass Julian nichts erfinden müsste; die leidvollen Erfahrungen befreiten ihn von dieser Pflicht." Er ist sich völlig darüber im Klaren, dass ihm die Aufmerksamkeit, die er bekommt, niemals genug ist. "Zu schreiben sei einfach nur eine Möglichkeit der Selbstjustiz", sagt er. Der andere, ein Exemplar des Rebellentums, heißt Louis, und auch er schreibt autobiographisch. Allerdings schreibt Louis von den banalen Dingen seines Alltags, und "seine Schilderungen des Essens, Trinkens, Scheißens, Pissens und Fickens - und noch öfter des Masturbierens" - hielten viele Leser für langweilig, während Julians Bücher von unerhörten (Missbrauchs-)Erlebnissen handelten. Beide Bücher waren enorme Erfolge. Man braucht nicht weit zu gehen, um zu begreifen, von wem hier die Rede ist. Rachel Cusk ist eine ausgesprochene Verehrerin von Knausgård. Darüber, was ihre Erzählerin vorliest, erfahren wir nichts.
Wohin führt das? Das Kapitel über die Lesung auf dem Open-Air-Literaturfestival kann als poetologische Suchbewegung, als Kommentar zu den verschiedenen Modi des Schreibens und der Verwandlung von Erfahrung in Geschichten gelesen werden. Diese Abzweigung in das Schreiben anderer betont die passive Haltung der Erzählerin in dem vorliegenden Buch, weil die zwei Schriftstellerkollegen so deutlich machen, wo der Machtanteil am Erzählen liegt und dass es diese Kontrolle über das Geschehen ist (auch bei der Lesung übrigens), die ihnen das Schreiben so wertvoll macht.
Warum aber schreibt die Erzählerin? Um dem Leben die Fiktionen auszutreiben? Dazu ist sie nicht angriffslustig genug. Freiheit ist eines der wiederkehrenden Motive, die Freiheit, die man aufgibt, wenn man sich die Haare färbt, oder auch die Freiheit, Menschen zu verlassen. Zwischendurch ziehen sich die Episoden dahin, von einer Studentin, die Marsden Hartley verehrt oder auch nicht, Gespräche münden in Kalendersprüchen ("Freiheit ist, sagte ich, wenn man aus dem Haus geht und es kein Zurück gibt") oder versanden vollends.
Doch dann, im allerletzten Kapitel, scheint sich das Schreiben doch noch von all dem zu erholen und zu emanzipieren, was es alles nicht sein soll. Eine Erzählung kommt in Gang. Eine Erzählung voller Atmosphäre, etwa einer Autofahrt durch dichten Nebel zum Haus eines Vetters, der eine neue Frau hat und zum Abendessen eingeladen hat. Eine Horrorveranstaltung, wie sich herausstellt, ein Reigen von Grausamkeiten, Heuchelei und Betrug, der von der Erzählerin als eine Art endlich erreichter Läuterung angesichts des misslungenen Lebens wahrgenommen wird, aus dem sie endlich fortschleichen kann. "Ich nahm eine Veränderung wahr, tief unter der Oberfläche aller Dinge."
Das nächste Buch, dürfen wir vermuten, wird auf der Grundlage dieser Veränderung auf der letzten Seite von "Transit" geschrieben.
VERENA LUEKEN.
Rachel Cusk: "Transit".
Roman.
Aus dem Englischen von Eva Bonné. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 238 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main