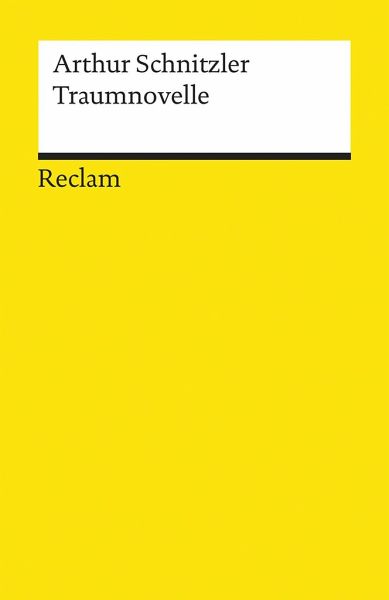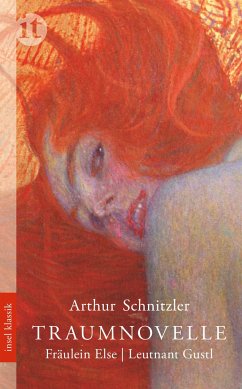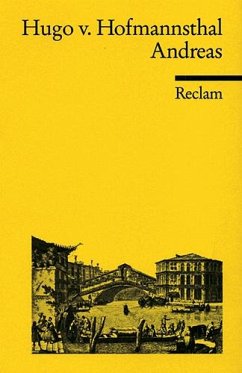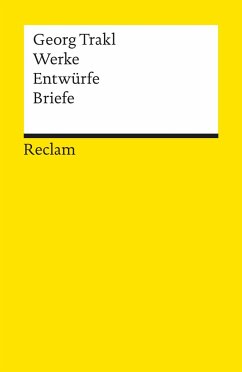Arthur Schnitzler
Broschiertes Buch
Traumnovelle

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Die scheinbar glückliche Ehe von Fridolin und Albertine wird auf die Probe gestellt, als Fridolin in den Straßen Wiens nach erotischen Abenteuern sucht, während seine Frau sich ihrerseits der Phantasie hingibt, ihren Mann zu betrügen. Doch liegt im Ausleben geheimer Begierden die ersehnte Erfüllung? Schnitzlers Traumnovelle handelt von menschlichen Sehnsüchten und Trieben vor dem Hintergrund erster wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet der Psychoanalyse. 1999 wurde sie von Stanley Kubrick unter dem Titel Eyes Wide Shut verfilmt.
Arthur Schnitzler (15. 5. 1862 Wien - 21. 10. 1931 ebd.) studierte ab 1879 Medizin in Wien mit anschließender Promotion und arbeitete als Arzt und Assistent seines Vaters; nach dem Tod des Vaters hatte er eine eigene Praxis. Daneben betrieb er mehr und mehr seine schriftstellerische Tätigkeit. Schnitzler ist einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne um 1900. Das Unbewusste und Motive des Fin-de-Siècle-Lebensgefühls bestimmen seine psychologische Darstellungskunst.

Produktdetails
- Reclams Universal-Bibliothek 18455
- Verlag: Reclam, Ditzingen
- Seitenzahl: 125
- Erscheinungstermin: 15. Januar 2006
- Deutsch
- Abmessung: 147mm x 98mm x 13mm
- Gewicht: 73g
- ISBN-13: 9783150184554
- ISBN-10: 315018455X
- Artikelnr.: 20928879
Herstellerkennzeichnung
Reclam Philipp Jun.
Siemensstr. 32
71254 Ditzingen
auslieferung@reclam.de
»Nicht erst seit die ganze Welt Mund-Nasen-Schutz trägt, stellen Masken die Liebe auf die Probe« DIE ZEIT, 07.12.2020
Verbalerotik
Die «Traumnovelle» gehört zum Spätwerk des österreichischen Schriftstellers Arthur Schnitzler, der mit seiner Dichtung die Öffentlichkeit des Fin de Siècle immer wieder in helle Aufregung versetzt hat. Als promovierter Arzt demaskierte er …
Mehr
Verbalerotik
Die «Traumnovelle» gehört zum Spätwerk des österreichischen Schriftstellers Arthur Schnitzler, der mit seiner Dichtung die Öffentlichkeit des Fin de Siècle immer wieder in helle Aufregung versetzt hat. Als promovierter Arzt demaskierte er nämlich unbeirrt die verlogenen sexuellen Konventionen der damaligen Gesellschaft, die er einer ebenso hellsichtigen wie unerbittlichen psychischen Analyse unterzog, was ihn als literarischen Mitstreiter seines Landsmannes Sigmund Freud ausweist. Er nahm in gleicher Schärfe den absurden Ehrenkodex des Militärs ins Visier, aber auch die unverhohlen antisemitische Stimmung breiter Kreise der österreichischen Bevölkerung. Besonderen Anstoß jedoch erregte die Thematisierung von Sexualität in seinem dichterischen Werk, wobei die Szenenreihe «Reigen» von 1901 die wohl heftigsten Skandale heraufbeschwor, denen dann jahrzehntelange Aufführungsverbote folgten. Und auch die 1926 erschienene Traumnovelle mit ihrer den Zeitgenossen unanständig erscheinenden Handlung wurde damals angefeindet. Ist hier doch, seiner Vorliebe für psychische Themen folgend in einer zwischen Traum und Wirklichkeit oszillierenden Geschichte, unterdrückte Sexualität am Beispiel eines typischen bürgerlichen Ehepaares jener Zeit dargestellt. Deren Triebleben bildet eine – noch Jahrzehnte später anzutreffende – Wirklichkeit ab, in der die Frau völlig naiv und unerfahren jungfräulich in die Ehe geht, der Mann hingegen sich sprichwörtlich «schon die Hörner abgelaufen hat».
Fridolin ist Arzt und treusorgender Ehemann, Albertine brave Ehefrau und Mutter eines kleinen Mädchens. Nach einem Maskenball, durch heftige Flirts in aufgeputschter Stimmung, erzählen sie sich von erotischen Erlebnissen während des Urlaubs in Dänemark. Sie hatte sich in einen markigen Dänen verguckt, er war am Strand einem blutjungen nackten Mädchen begegnet, keiner von ihnen aber war untreu geworden. Entsprechend aufgestachelt hat Fridolin nun am folgenden Tage einige Begegnungen mit willfährigen Frauen, erreicht nachts schließlich voller Neugier sogar unerlaubt Zutritt zu einer geheimnisvollen Orgie mit maskierten nackten Weibsleuten, er widersteht jedoch dem allen und bleibt treu.
Als er früh um Vier nach Hause kommt, wacht Albertine auf und erzählt ihm ihren Traum. Sie waren auf Hochzeitsreise, haben sich auf einer Wiese geliebt, beim Aufwachen seien alle ihre Kleider verschwunden gewesen. Er habe sich auf die Suche danach begeben, da sei der Däne erschienen und habe im Beisein vieler anderer nackter Paare mit ihr geschlafen. Fridolin aber sei verhaftet und nackt in Ketten gelegt worden, die Fürstin wollte ihn begnadigen, wenn er ihr Liebhaber würde, sie habe ausgesehen wie das junge Mädchen am Strand. Fridolin sei standhaft geblieben, wurde deshalb ans Kreuz geschlagen, sie aber, Albertine, habe ihn ausgelacht.
In seiner vor Metaphorik und Symbolik nur so strotzenden, rasant erzählten Geschichte dringt Schnitzler tief hinein in das Seelenleben seiner beiden Figuren, macht ihre einer verlogenen Moral wegen unterdrückte Sexualität sichtbar, deckt unterschwellig vorhandene Triebe auf. Bemerkenswert ist, dass Fridolin reale Erlebnisse hat, Albertine jedoch nur träumt, der Autor also – unbewusst? – damit spezifische Unterschiede der Geschlechter postuliert in seinem Plot. Sie ist auf seine vorehelichen Erfahrungen neidisch, missgönnt sie ihm sogar und kann sich nun, nachträglich nur und, will sie ihm treu bleiben, auch nur im Traume ihre geheimen sexuellen Wünsche erfüllen, ihr bleibt also nur das für sie erregende Gespräch mit ihrem Mann über ihre diesbezüglichen Phantasien. Verbalerotik mithin, Stanley Kubrick hat genau das in «Eyes Wide Shut» – prüde amerikanisch natürlich – filmisch umgesetzt. Schnitzlers Novelle zu lesen hingegen ist deutlich interessanter und regt weit mehr zum Interpretieren und Nachdenken an.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für