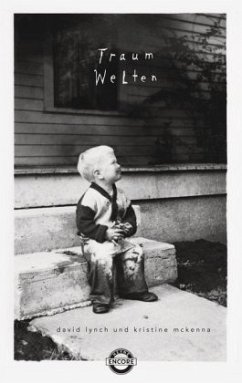Ein einzigartiger Einblick in das persönliche und kreative Leben des visionären Künstlers David Lynch, erzählt von ihm selbst und seinen engsten Kollegen, Freunden und Verwandten.
In einer faszinierenden Mischung aus Biografie und Memoire schreibt David Lynch erstmals über seine vielen Kämpfe und auch Niederlagen; wie kompliziert es oft war, seine zahlreichen unorthodoxen Projekte zu verwirklichen. Lynch kommentiert ungefiltert und auf sehr offene Art und Weise die biografischen Ausführungen seiner Co-Autorin Kristine McKenna, die für das Buch über hundert Interviews mit erstaunlich gesprächigen Ex-Frauen, Familienmitgliedern, Schauspielern, Agenten, Musikern und sonstigen Kollegen geführt hat.
Traumwelten ist ein besonderes Buch, das dem Leser eine tiefe Einsicht in das Leben und die Gedankenwelt eines der schillerndsten und originellsten Künstlers unserer Zeit gewährt.
In einer faszinierenden Mischung aus Biografie und Memoire schreibt David Lynch erstmals über seine vielen Kämpfe und auch Niederlagen; wie kompliziert es oft war, seine zahlreichen unorthodoxen Projekte zu verwirklichen. Lynch kommentiert ungefiltert und auf sehr offene Art und Weise die biografischen Ausführungen seiner Co-Autorin Kristine McKenna, die für das Buch über hundert Interviews mit erstaunlich gesprächigen Ex-Frauen, Familienmitgliedern, Schauspielern, Agenten, Musikern und sonstigen Kollegen geführt hat.
Traumwelten ist ein besonderes Buch, das dem Leser eine tiefe Einsicht in das Leben und die Gedankenwelt eines der schillerndsten und originellsten Künstlers unserer Zeit gewährt.

Die gar nicht so seltsame Biographie eines Künstlers, der ziemlich seltsame Sachen malt, dichtet und dreht: "Traumwelten" von Kristine McKenna und David Lynch gibt Letzterem eine feine Gelegenheit, sein Leben zu rezensieren.
Der ausgesucht höfliche, ein bisschen linkische, aber alles andere als demonstrativ introvertierte Mensch kam aus einer Kleinstadt, wo alle und alles zu dicht aufeinanderhockten. Dort wollte er nicht bleiben, weil er es vorzog, sich einen Ort zu suchen, wo die Widersprüche der Wirklichkeit, des Empfindens und des Denkens ein bisschen mehr Platz haben als im Gewöhnlichen, um aufeinander zu wirken und sich füreinander zu interessieren. Weil die Überwindung der inneren Enge, die sich als Abdruck der kleinstädtisch und kleinbürgerlichen äußeren in die Seele prägt, anstrengende Arbeit ist, ließ er sich unterwegs von einer Sekte das Meditieren beibringen. Ganz darin verschwunden ist er zum Glück nie; ein Nirwana, wo sich Widersprüche auflösen wie Kandis in heißem Tee, interessiert ihn nicht.
Statt also der Erleuchtung hinterherzulaufen, beschäftigt er sich lieber damit, die Schönheit abgeschnittener Ohren ("Blue Velvet", 1968), knirschender Tonspurmanipulationen, die sich anhören, als hätte jemand alle Mikrofone am Drehort durch Gewürzmühlen ersetzt ("Twin Peaks: Fire Walk With me", 1992), und verschmierter Gesichtszüge auf dehnbaren Oberflächen ("Inland Empire", 2006) gleichzeitig zu untersuchen, zu inszenieren, zu fürchten und zu feiern.
Zum Kino, wo er all das treibt, kam David Lynch von der Seite: Er war Student der Malerei, als sich auf einem seiner Gemälde "ein Windhauch" regte, wie er sagt. Der junge Künstler sah's als Hinweis, dass seine Arbeit sich bewegen wollte, und nahm den ersten Film in Angriff, bei dem unter anderem Polyesterharz außerplanmäßig Feuer fing und zwei volle Monate Dreharbeiten nicht die geplanten zweieinhalb Minuten Spielzeit hervorbrachten, sondern zunächst überhaupt nichts - die Kamera war kaputt, keinerlei Aufzeichnung hatte stattgefunden. David Lynch "schlug die Hände vors Gesicht und weinte zwei Minuten lang. Dann sagte er ,Scheiß drauf!' und ließ die Kamera reparieren. Er war immer sehr diszipliniert."
Das Buch "Traumwelten" von Kristine McKenna und David Lynch, in dem diese Anekdote steht, hat mit Recht keine Lust, sich zu entscheiden, ob es lieber eine Recherche der Autorin oder eine Autobiographie des Autors sein will. Wohltuend wenig wird in dem dicken, aber kurzweiligen Band psychologisiert oder genealogisiert (die Mutter ein Stadtmensch, der Vater vom Land, Yin, Yang, Ahörnchen und Behörnchen, so what?). Stattdessen bleibt eine wichtige Wahrheit dezent, aber durchgängig im Hintergrund präsent: Wären David Lynchs Filme, graphischen Erzeugnisse und unklassifizierbaren Online-Experimente nicht so eigen, würde sich niemand für Lynchs Biographie interessieren, die nicht sonderlich eigen ist; man kann Leuten, die Kunst verstehen wollen, nichts Besseres und Gesünderes in die Hand geben als einen Text, der sich nirgends darüber betrügt, dass Herkunft bei Kunst nichts erklärt, nichts verbürgt und nichts beweist, sondern den vielen Brillen, durch die man sie betrachten kann, nur eine weitere hinzufügt, nicht besser und nicht schlechter als andere.
Kristine McKenna ist Journalistin und seit Jahrzehnten mit Lynch befreundet. Für "Traumwelten" (im Original zugleich bescheidener und vager, also absolut lynchgemäß: "Room to Dream") hat sie sämtliche Menschen befragt, die Lynch je gesprochen, an ihm gerochen oder ein Stück von ihm abgebissen haben. Die Kapitel, in denen sie die Protokolle dieser Unterredungen (gekürzt aufs mehr oder weniger Verständliche) wiedergibt, wechseln ab mit anderen, in denen Lynch ihr weniger widerspricht, als sie vielmehr so ausführlich ergänzt, dass man beiden nicht mehr so recht glaubt, aber immer lieber dabei zuschaut, wie sie so plausibel wie möglich ihre vieldeutigen Geschichten spinnen. Erfunden haben sie diese Buchform nicht, Geoffrey Benningtons hübsche Derrida-Schwarte von 1991 funktioniert sehr ähnlich, wobei sich der französische Dazwischendenker anders als Lynch freilich nicht mit Scharnierkapiteln abspeisen ließ, sondern direkt mit Fußnoten in den Text des Gegenübers grätschte, auf den deshalb genauso wie auch auf "Traumwelten" die anschauliche deutsche Wertung "nicht ganz dicht" passt - aber auch eine Dusche ist nicht ganz dicht, und man stellt sich gern drunter, wenn sie frisch genug sprüht.
Tastend, respektvoll und ohne vorschnelle Gesamturteile nähert sich "Traumwelten" insbesondere einem heiklen Gebiet, das man "Lynchs Humor" nennen könnte, wenn das Wort nicht so abgegriffen wäre und wenn das, was man im Fall Lynch damit meint, nicht einerseits ein bisschen korrosiver und böser als herkömmlicher Humor, andererseits aber auch wieder weniger spitz und scharf als Satire, Sarkasmus oder sonst eine Distanz zum Gegenstand der künstlerischen Tätigkeit setzende Art von Witz wäre.
Lynch hat seine Mitmenschen offenbar schon als Kind komisch gefunden und ihnen das auch mitgeteilt, aber eben bereits damals so, dass man ihm gar nicht so leicht eine Spott- oder Karikaturabsicht nachweisen konnte: "Die meisten trugen damals einfarbige T-Shirts, und David fing an, die Hemden nach den Wünschen seiner Kunden mit Magic Markers zu gestalten. Alle in der Nachbarschaft kauften welche. Ich erinnere mich noch, dass Mr. Smith, unser Nachbar, eins für einen Freund kaufte, der schon vierzig war. David beschrieb es mit dem Spruch ,Das Leben beginnt mit 40' und malte dazu das Bild eines Mannes, der eine hübsche Frau anstarrt." Das hat, wie die windschiefen Menschenporträts in Lynchs späteren Filmen, fast nichts mit irgendeinem antibourgeoisen Angriff aufs Normale, mit Surrealismus, mit Luis Buñuel oder Thomas Ligotti zu tun, deren Arbeiten man mit seinen oft verkehrt verklammert, dafür aber viel mit "I Love Lucy", den "Simpsons" und einer Art Tongue-in-cheek-Humanität, die man in Abwandlung der kernamerikanischen Formel "tough love" wohl "harte Nächstenliebe" nennen kann.
Natürlich stehen bei rund sechshundert (das Original) beziehungsweise siebenhundert (die deutsche Fassung) Seiten Text nicht nur solche aufschlussreichen Sachen im Buch, sondern auch ein paar anfechtbare; etwa wenn jemand sich entsinnt, das Haus in Boise/Idaho, in dem die Lynchs während der Kindheit des kleinen David wohnten, sei "so gräßlich" gewesen wie das wichtigste Gebäude in "Blue Velvet". In Wahrheit steht der Bau, den Lynch für den Film ausgesucht hat, als einziges ehrliches Gebäude an einer von nutzlosen Prunksäulen und Breite-Treppen-Angeber-Stuss aus der Südstaaten-Sklavereizeit beherrschten Kreuzung, und "gräßlich" ist bei Lynch sowieso nichts, dazu sind seine Schocks viel zu nah an Juckpulver und Kitzelattacken: Ausgeburten einer weder je völlig erwachsenen noch im harmlos-putzigen Sinn kindlichen Phantasie, die sich für Mord und Totschlag, Inzest und Vergewaltigung nicht etwa so interessiert wie ein Horrorkünstler für Monster, sondern so, wie sich ein Monster, das gar nicht weiß, dass es ein Monster ist, für die Nichtmonstrosität interessieren könnte, die man "normal" nennt - und die Lynch so darstellt wie der große F.W. Bernstein in seinen besten Versen das Freudsche "Unheimliche": "Horch - ein Schrank geht durch die Nacht, / voll mit nassen Hemden. / Den hab ich mir ausgedacht / um euch zu befremden."
Die Brillanz der Regieleistungen des David Lynch, behauptet das Buch einmal, beruhe "zum großen Teil" auf der Fähigkeit des Meisters, "Schauspieler an Orte zu führen, die ihnen bis dahin fremd waren". Aber ganz offensichtlich, man muss nur hinsehen, bleiben diese Orte den Schauspielern auch dann noch fremd, wenn er sie hingeführt hat, und außerdem sind und bleiben sie auch ihm selbst fremd, deshalb will er ja hin, mit den anderen - eine Utopie: Absichtliche Fremdheit bringt uns einander näher. So kann man Filme machen, in denen nichts passt, aber alles stimmt - und außerdem, wie sich zeigt, ein sehr nettes Buch.
DIETMAR DATH
David Lynch und Kristine McKenna: "Traumwelten".
Ein Leben. Aus dem Amerikanischen von R. Brack, D. Müller, W. Dorn und S. Glietsch. Heyne Encore Verlag, München 2018. 768 S., Abb., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
David Lynchs »Autobiographie ist ein Dialog zwischen ihm und Kristine McKenna in dem beide dem Geheimnis dieser Welt gefährlich nahe kommen.« ttt - titel, thesen, temperamente