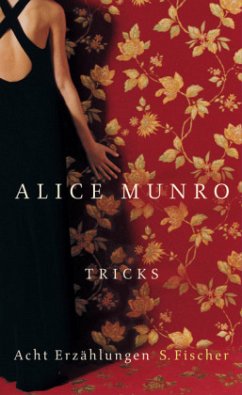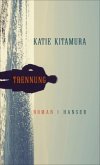Nobelpreis für Literatur 2013
Tricks, acht meisterliche Erzählungen von Alice Munro: Geschichten über Ausreißer, Entscheidungen, Leidenschaften und Verfehlungen.
Wieder beweist Alice Munro besonderes Gespür für das Geheimnis ihrer Figuren, jenen rätselhaften Bereich, wo Selbstbetrug auf Hoffnungen, gefährliche Illusionen auf die kleinen Tricksereien des Alltags treffen. Der Leser kommt in ihren Geschichten seinem eigenen Leben so nah, dass er schwindlig wird vor Herzleid und Glück.
Tricks, acht meisterliche Erzählungen von Alice Munro: Geschichten über Ausreißer, Entscheidungen, Leidenschaften und Verfehlungen.
Wieder beweist Alice Munro besonderes Gespür für das Geheimnis ihrer Figuren, jenen rätselhaften Bereich, wo Selbstbetrug auf Hoffnungen, gefährliche Illusionen auf die kleinen Tricksereien des Alltags treffen. Der Leser kommt in ihren Geschichten seinem eigenen Leben so nah, dass er schwindlig wird vor Herzleid und Glück.

Von wegen romanhafte Abrundung: Alice Munro erzählt in "Tricks" von Unfällen und tröstet die Geschlagenen
Sie sei eigentlich im neunzehnten Jahrhundert aufgewachsen, sagt die große kanadische Erzählerin von sich. Damit spielt die heute fünfundsiebzigjährige Alice Munro auf die calvinistischen Tugenden an, mit denen sie aufwuchs: Demut, Gottvertrauen und ehrliche Arbeit. Hatte sie als Schülerin 95 von 100 Punkten in einem Test, bekannte sie in einem Interview, habe sie sich für die fünf fehlenden Punkte geschämt. Kein Wunder, daß die Fama vom möglichen Nobelpreis sie nur erschrecken kann. "Denn wahrscheinlich wird man zu Unrecht gelobt", sagt sie, "wahrscheinlich ist man in Wahrheit ein Sünder." Ohne dem Stockholmer Komitee vorgreifen zu wollen, darf man sagen: Die Erzählerin Alice Munro hat ihre Hausaufgaben gemacht. 95 Punkte sind ihr sicher, und der Abstand zur Höchstpunktzahl wird von Buch zu Buch kleiner.
Das beweist ihr neuester Band mit Erzählungen aus der kanadischen Provinz. "Tricks" heißt die deutsche Ausgabe, "Runaway" der Originaltitel. Vom Ausreißen einer Frau handelt die erste der acht Geschichten, auch die anderen ihrer zumeist weiblichen Protagonisten sind irgendwie auf der Flucht. Von "Tricks" ist mehrmals die Rede, nicht bloß in der gleichnamigen Story. Aber merkwürdig genug: Die Autorin selbst scheint ohne Tricks auszukommen und gibt sich eher kunstlos. Manchmal scheint sie den Faden zu verlieren, zuletzt fängt sie sich immer. Die Schlüsse bleiben gern offen. Das ist der Munro-Effekt: Man meint dem wirklichen Leben begegnet zu sein. Seiner Unauflösbarkeit, seiner Unwiderruflichkeit, seinem Schauer, der uns streift. Dennoch ist es Kunst, scheinbar kunstlose Kunst.
Nacherzählen vermittelt allenfalls eine Ahnung. Carla, die Protagonistin von "Ausreißer", kehrt zu Clark, ihrem streitsüchtigen Mann, zurück. Im Bus nach Toronto hat sie noch einen "Beatles"-Song gesummt: "She's leaving home, bye-bye." Da steigt sie vor dem Ziel aus, läßt sich zurückholen, arrangiert sich und meint noch lange, in ihrer Lunge eine tödliche Nadel zu spüren. Eine simple Story. Wäre da nicht die Ziege Flora, die zwischen den dreien eine merkwürdige Rolle spielt. Ist Eifersucht im Spiel oder Haß? Wir erfahren es nicht. Doch das Geheimnis rührt uns an. Als Flora verschwindet, halluziniert Carla, das Tier liege am Waldrand, ein Fest für Geier. Sie widersteht der Versuchung, dem nachzugehen. Die Erzählerin vermutet: "Vielleicht war sie frei."
"Vielleicht" steht über vielen Geschichten. Sosehr sich Alice Munro an ein calvinistisches Sündenbewußtsein gebunden fühlt - ihre Protagonistinnen sind Kinder einer säkularisierten Welt, kommen fast immer ohne Schuldgefühle aus und zeigen sich in Kalamitäten eigentümlich flexibel. Vor allem sind sie widerstandsfähig: Frauen, die unterliegen, aber nicht zerstört werden. Keine sieht sich als Heldin, alle überwinden auch die nächste Enttäuschung. Jede wäre für weitere Geschichten gut.
Juliet ist es auf jeden Fall. Sie, eine klassische Philologin, die ihre Doktorarbeit nie beenden wird, figuriert in drei Geschichten: Stoff für einen Entwicklungs- oder Familienroman. Doch schon die erste Story sabotiert die Erwartung auf romanhafte Abrundung oder Sinnstiftung. Was passiert, ist eher beiläufig katastrophisch, etwa das, was Juliet während ihrer Bahnreise widerfährt, als der Zug wegen eines Hindernisses anhält. Der Mann, der sich vor den Zug geworfen hat, ist just der, der ihr kurz zuvor eher ungeschickt als aufdringlich vorgeschlagen hatte, man könne sich "ja irgendwie zusammentun." Ohne Schuld keine Sühne. Juliet wird ihr Leben weiterführen. "Es war einfach etwas, an das man sich gewöhnte, ein neues Leben. Das war alles." In der zweiten Geschichte hat Juliet sich mit dem Unfalltod ihres Mannes abzufinden, in der dritten mit dem Faktum, daß ihre Tochter Penelope sich für immer von ihr losgesagt hat. Was bleibt am Ende? Es ist mit den Worten der Autorin die Hoffnung "auf einen unverdienten Glücksfall, auf spontanen Straferlaß, auf derlei Dinge".
Doch derlei Dinge geschehen nicht in einer Welt, die sich zunehmend verdüstert. Kein Gott greift ein. Es gibt Unfälle, keine Novellen; Karrieren und Abstürze, keine Romane. Und geht man ins Theater, um Shakespeare zu sehen, kommt es in Wirklichkeit besonders schlimm. In "Tricks" zerstört eine gräßliche Verwechslung das Glück der Krankenschwester Robin. Nach einer Shakespeare-Aufführung hat sie einen Mann kennengelernt. Man verabredet ein Wiedersehen in einem Jahr. Bei diesem Wiedersehen wird sie brutal abgewiesen. Das Rätsel löst sich erst, als sie nach Jahren in einer Anstalt auf einen Mann trifft, der sich als der taubstumme und aggressive Zwillingsbruder des seinerzeit bereits verstorbenen Freundes erweist. Jetzt erst begreift sie den Streich, den ihr das Schicksal spielte.
Auch bei Shakespeare, sinniert die Erzählerin, haben Verwechslungen katastrophale Folgen. Doch am Ende "sind die Rätsel gelöst, die üblen Streiche vergeben, die wahre Liebe oder etwas Ähnliches flammt wieder auf, und jene, die zum Narren gehalten worden sind, besitzen den Anstand, sich nicht zu beklagen". Nichts davon im wirklichen Leben. Nichts davon in Munros Welt. Da schlägt der Zufall zu, wie er will. Doch vielleicht ist diese Welt so eingerichtet, damit die düpierten Menschen ihre Lebenszähigkeit beweisen können. Und wo das zweifelhaft wird, muß die Kunst zu einem Zauber greifen, der das Unheil wenigstens mildert. Robin, suggeriert die Autorin, werde vielleicht für die Aufdeckung ihres Unheils dankbar sein - für eine Aufdeckung, "die alles heil läßt, bis zu dem Augenblick des tückischen Eingriffs. Die Empörung auslöst, aber von Ferne wärmt, von aller Scham befreit."
Das alte Spiel: um Reinigung, Katharsis. Es kann offenbar nur darum gehen, die Schläge hinzunehmen und die Geschlagenen zu trösten - mit einer Empörung, die uns von unseren Glückserwartungen befreit. Man spricht davon mit Understatement, läßt die Autorin durchblicken. Es gehört zu ihrer Kunst. Warum nicht? Auch Shakespeare hatte seine Tricks.
Alice Munro: "Tricks". Acht Erzählungen. Aus dem Englischen übersetzt von Heidi Zerning. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006. 380 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Restlos ins Schwärmen gerät die Rezensentin Verena Auffermann angesichts dieses jüngsten Erzählbandes der kanadischen Autorin Alice Munro. Mit dem Verweis auf Einflüsse und Vorbilder wie Tschechow und Shakespeare will sie durchaus auch Munro selbst nobilitieren, der es zentral um das gehe, was das Leben aus uns macht, mit dem Vergehen der Zeit, mit den Erfahrungen, die wir machen. Und doch spiele gerade der Zufall eine sehr große Rolle, wenn zusammentrifft, was nicht - oder vielleicht doch - zusammengehört, wie etwa Juliet auf den verheirateten Mann, den sie liebt, ausgerechnet am Tag, an dem er seine Frau beerdigt. Spuren der Tagesaktualität finden sich kaum in diesen Erzählungen, so Auffermann, aber das sei gerade eine Stärke, denn zu entdecken seien deshalb "Strukturen" von Zusammenhängen, die so schnell nicht veralten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH