Nicht lieferbar
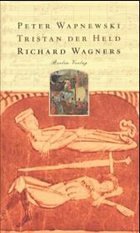
Tristan der Held Richard Wagners
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der "Tristan" ist Wagners persönlichstes Werk, am wenigsten bestimmt von Ideologie und Weltenspekulation, am mächtigsten bewegt von innerem Aufruhr und privater Mythologie. Fern von Drachen, Zwergen, Riesen und Wassernixen nimmt diese zutiefst menschliche Liebestragödie ihren Lauf, die Geschichte von Tristan und Isolde, eines der großen Liebespaare der abendländischen Überlieferung.Peter Wapnewskis Studie über diesen Inbegriff der spätromantischen Oper ist ein Geschenk, entstanden aus Leidenschaft und Überfluss, Leidenschaft für die Musik Richard Wagners und unerschöpflichem Kenntni...
Der "Tristan" ist Wagners persönlichstes Werk, am wenigsten bestimmt von Ideologie und Weltenspekulation, am mächtigsten bewegt von innerem Aufruhr und privater Mythologie. Fern von Drachen, Zwergen, Riesen und Wassernixen nimmt diese zutiefst menschliche Liebestragödie ihren Lauf, die Geschichte von Tristan und Isolde, eines der großen Liebespaare der abendländischen Überlieferung.
Peter Wapnewskis Studie über diesen Inbegriff der spätromantischen Oper ist ein Geschenk, entstanden aus Leidenschaft und Überfluss, Leidenschaft für die Musik Richard Wagners und unerschöpflichem Kenntnisreichtum. Hier schreibt einer der bedeutendsten Wagnerkenner, ein prägender Mediävist, der es wie kein Zweiter vermag, den Tristan in seinem geistigen Umfeld zu zeigen: Gottfried von Straßburg macht um 1200 den großen Anfang, Thomas Mann liefert in seiner Tristan-Novelle von 1901 das bürgerliche Nachspiel, in Wagner wird die Kühnheit des Stoffes aufgehoben in der Kühnheit der Musik, Mittelalter in Gegenwart, Gegenwart in Zukunft projiziert. Wapnewski gelingt es meisterhaft, das eine im anderen, die Partitur im Text zu verstehen und eben dadurch das Werk in seiner einsamen Eigengesetzlichkeit zu begreifen.
Peter Wapnewskis Studie über diesen Inbegriff der spätromantischen Oper ist ein Geschenk, entstanden aus Leidenschaft und Überfluss, Leidenschaft für die Musik Richard Wagners und unerschöpflichem Kenntnisreichtum. Hier schreibt einer der bedeutendsten Wagnerkenner, ein prägender Mediävist, der es wie kein Zweiter vermag, den Tristan in seinem geistigen Umfeld zu zeigen: Gottfried von Straßburg macht um 1200 den großen Anfang, Thomas Mann liefert in seiner Tristan-Novelle von 1901 das bürgerliche Nachspiel, in Wagner wird die Kühnheit des Stoffes aufgehoben in der Kühnheit der Musik, Mittelalter in Gegenwart, Gegenwart in Zukunft projiziert. Wapnewski gelingt es meisterhaft, das eine im anderen, die Partitur im Text zu verstehen und eben dadurch das Werk in seiner einsamen Eigengesetzlichkeit zu begreifen.



