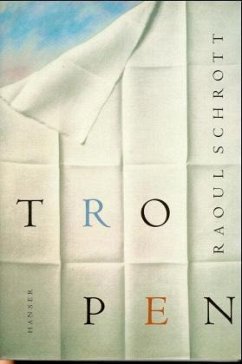Lyrik ist nicht zeitgemäß? Raoul Schrott beweist das Gegenteil. Er ist ein Dichter, der Unterschiedlichstes vereint: Brillanz und Gelehrtheit, das Alte und das Moderne, das Exotische und das Nahe, Natur und Wissenschaft.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Raoul Schrott sucht das Erhabene · Von Harald Hartung
Was Raoul Schrott in seinem vor einem Jahr erschienenen Band "Die Erfinung der Poesie aus den "ersten viertausend Jahren Poesie" zusammengetragen hatte, faszinierte als gelungenes Paradox: Das Älteste wirkte frisch wie am ersten Tag, das Fremdeste irgendwie vertraut. Dieser schöne Effekt war freilich ambivalent. Der Liebhaber der Musen, ein stupender Kenner, der aus mindestens neun alten Sprachen übersetzt, hatte entschlossen Ezra Pounds Devise "Make it new!" befolgt - wenngleich mit dem Resultat, daß selbst sumerische, arabische oder altirische Poesien zwar erstaunlich modern, aber auch ein bißchen wie Raoul Schrott klingen. Da können Philologen noch so viel rechten und im Detail auch recht haben - Schrott hatte nur von jener Lizenz Gebrauch gemacht, die Pound für sich beansprucht hatte: sich seine Tradition selbst zu zimmern. Ebendas war der Nebensinn des Titels: "Erfindung" von Tradition für den Eigengebrauch.
Doch ist der Liebhaber der Musen auch deren Liebling? Zu dieser Frage hatten die früheren Arbeiten - darunter zwei Gedichtbände - so recht keine Antwort nahegelegt. Sie waren freundlich, aber nicht enthusiastisch besprochen worden. Nun aber, nach den Maßstäben, die die Anthologie setzte, muß darüber neu verhandelt werden. Schrott selber hat die Meßlatte höher gelegt.
Auch sein neues Buch trägt einen Doppelsinn im Titel. "Tropen" heißt es, und ein erläuterndes Stichwort auf dem Umschlag hilft uns auf die Sprünge. Tatsächlich entführt uns Raoul Schrott auch geographisch in tropische Bereiche, vor allem aber in die imaginären "Tropen" der poetischen Bilder und Figuren. In dieser Sphäre geht es ihm um ein gewaltiges Thema. Sein Werk handelt - laut Untertitel - "Über das Erhabene".
Das "Über" ist wichtig. Es klingt nach Essay, Untersuchung, Recherche. Von jenen Poeten, die das Erhabene dichterisch erringen wollen, unterscheidet sich Raoul Schrott durch seinen forschenden Impuls. "Tropen" ist ein Vermessungsversuch von Terrains der physikalischen Optik, der Perspektive, aber auch des Mythos, der Historie oder der Malerei. Und da es bei alldem nicht um bloßes Wissen geht, sondern um Poesie, genauer: um ein großes Lehrgedicht, zieht Schrott dem Enzyklopädischen eine vertikale Perspektive ein, eben die Frage nach dem Erhabenen.
Was es mit diesem Erhabenen auf sich hat, sagt uns der Autor gleich zu Beginn. Da stehen wir mit unserem Tropen-Führer in der algerischen Wüste, am "Tropique du Cancer", und hören dreierlei: daß das Erhabene auf einer Projektion beruht; daß wir - mit Niels Bohr - nicht wissen, was die Natur ist, aber etwas über sie sagen können; und daß das "Sublime" nicht behauptet werden kann "als Block von Gedichten und als einzige Stimme". Aber wie denn und wo? "Statt dessen" - und damit läßt Schrott seine poetologische Katze aus dem Sack - "liegt es in Tonfällen und Stimmhaltungen, Stücken, Lagen und Schichten." Will sagen: nicht in der unverwechselbaren subjektiven Stimme, sondern in der persona, in dem, was aus der Maske tönt.
Nachdem uns der weltläufige guide derart aufgeklärt hat, kommt er endlich zur Sache. Denn "Tropen. Über das Erhabene" möchte schließlich doch Lyrik sein, ein Großgedicht in fünf "Stücken", und der Leser nimmt zwar die Glossen und Anmerkungen als üppige Beigabe, möchte aber Poesie und nicht bloß gelehrte Fußnoten lesen. Nun gilt es die Probe: Der Leser will die "Tropen" sehen, und aus ihnen soll es tönen. Sonst klappt er das ungeheuer kluge Buch zu.
Er wird es nicht tun, wette ich. Er wird weiterlesen, interessiert, fasziniert, oft hingerissen, manchmal auch verärgert. Nein, was sag' ich. Raoul Schrott kann man nicht böse sein. Nicht mal dort, wo er eitel wirkt in der Ausbreitung seiner Kenntnisse oder eitel in der Formulierung: "das sublime bewahrt seine lumineszenz", lautet so eine gebildet-kitschige Verszeile.
Manchmal schläft auch Homer, und Raoul Schrott ist auf weitesten Strecken hellwach: Er weiß inzwischen genau, was er nicht kann. Er hat einige mondäne Mätzchen abgelegt, die er in dem Band "Hotels" kultivierte. Er verzichtet auf private Konfession. Das lyrische Ich ist eher schwach entwickelt, vielleicht auch heikel und schamhaft. Schrott möchte ein objektiver Dichter sein. Man könnte ihn durchaus einen deutschen Schüler Pounds nennen. Den einzigen, den wir im Moment haben.
"Ich war ein anderer früher", heißt es in einem Gedicht über die "Elemente". Ein verstecktes Selbstbekenntnis. Raoul Schrott legt es Empedokles in den Mund. Der Dichter geht maskiert wie Pessoa, wie Pound. So hatte Pound in einem frühen Gedicht ("Histrichon") geschrieben: "Noch keiner hat gewagt dies auszusprechen:/ Doch weiß ich wie die Seelen aller Großen/Zuweilen durch uns ziehn". Und während Pound sich derart mit Dante oder Villon identifiziert, spricht Schrott aus der Rollenmaske von Dante und Petrarca, Masaccio oder Michelangelo, aber auch aus Galilei und Einstein, aus Newton und Niels Bohr.
Hybris ist Raoul Schrott fern, aber das Risiko, die Gefahr des Absturzes, ist natürlich dennoch enorm. Vielleicht muß man so jung sein wie Raoul Schrott, um es einzugehen. Ich kann nicht alle seine einschlägigen Gedichte rühmen und finde auch, daß man Petrarca und den Mont Ventoux inzwischen allzu reichlich bedichtet hat. Aber das Poem über den auch nicht gerade vom Andichten verschonten Michelangelo scheint mir doch außerordentlich gelungen - vielleicht weil es darin um Michelangelos Klage über einen Kunstfehler geht. Denn so lautet der Schluß: " . . . als endlich das gerüst / abgenommen wurde und die eine seite aufgedeckt / hätte ich die engel am liebsten auf den mund geküßt / doch die hatten inzwischen etwas anderes ausgeheckt / gott verdamme prostata ischias und mein zipperlein / die äpfel im paradies hätten sollen einfach größer sein."
Auf den Autor, dem so auch das Heikle gelingt, warten andere Gefahren, wenn es um die Umsetzung von Themen der Naturwissenschaft geht. Da lauert der lyrische Schulfunk, das versifizierte Feature. Auch hier zieht sich Schrott bemerkenswert gut aus der Affäre. Nicht so sehr beim vielbedichteten Galilei als etwa in den Texten zur allgemeinen und zur speziellen Relativität, in zwei fiktiven Monologen Albert Einsteins.
Man wertet Schrotts Leistung nicht ab, wenn man sagt, daß er vor allem bei seinen Porträts von Naturwissenschaftlern viel aus Enzensbergers "Mausoleum" (1975) gelernt hat, in dem seinerzeit der Fortschritt aufgebahrt wurde. Dort, bei Enzensberger, liest man in einem Gedicht auf den französischen Physiologen Marey: "Kurzum, ,die Welt' // ist eine Augentäuschung: Nichts sehen wir so, /,wie es ist', und das, was sich zeigt, verbirgt sich." Das könnte auch bei Schrott zitiert sein. Perspektivismus ist ein entscheidendes Motiv der "Tropen" und wohl auch ihrer Philosophie. Zu den Kapiteln des Buches gehören "Eine Geschichte der Perspektive", "Fallhöhen" (mit Einschluß des Relativitätsprinzips) sowie Texte über "Physikalische Optik". Andererseits ist uns nicht entgangen, wie sehr dieses Buch um das Erhabene kreist. Was also soll gelten, fragt man sich: die Perspektivik und Relativität - oder aber das Erhabene? Falsch gefragt, sagt der listige Poet, der uns aus seinen Furchen (Verse sind Furchen) listig anlächelt. Und wir bekennen schuldbewußt: Wir haben beim Erhabenen nicht richtig aufgepaßt.
Das Erhabene selber ist Täuschung, zumindest Perspektive. Das beweist jeder Sonnenuntergang. Oder das Alpenglühen der Berge (Schrott gelingen übrigens Gedichte über Berge). Kurz, das Erhabene ist Ausdruck einer existentiellen Haltung, die an der Natur scheitert. Bleibt nur die Kunst, die Sprache, die Poesie. Das Gedicht entwirft die Topographie des Erhabenen mit dem Raster seiner Tropen. So die Antwort des klugen Poetologen. "Raster" ist übrigens ein interessantes Wort.
Aber das Gedicht und selbst das Lehrgedicht, hält der Leser dagegen, ist doch wohl mehr als ein Fahndungsraster für das Erhabene. Irgendwo muß es doch selbst erscheinen? Vielleicht am ehesten dort, wo es um Pathos geht, also auch um Leiden. Einmal wird Burke mit dem Satz zitiert: "Was immer Gefahr und Schmerz auslöst, ist die Quelle des Sublimen." Mir ist aufgefallen, daß Raoul Schrott, wie auch andere jüngere Autoren, vom Krieg fasziniert ist - hier, in "Tropen" vom Ersten Weltkrieg. Nicht ohne Grund ist "Gebirgsfront 1916-18" das poetische Schlußstück. Es ist ein Stück Dokumentarlyrik, es beruht auf bereits publizierten Augenzeugenberichten italienischer und österreichischer Soldaten.
Dort, in einer Landschaft der Zerstörung, in der nur die Wolken unberührt bleiben - oder sagen wir lieber: in der Textlandschaft, die Krieg und Zerstörung sprachlich abbildet, heißt es gegen Ende: "dann steh ich auf / und küß dich auf den zerschossenen mund." Da, in der Koinzidenz von Liebe und Tod, rührt Raoul Schrott an das Erhabene. Die Kursivierung hebt die Zeilen hervor, sie verweist aber zugleich darauf, daß wir ein Zitat lesen.
Das Erhabene sei eine ästhetische Kategorie, sagt Schrott an anderer Stelle. Auch das lernen wir aus seinem Lehrgedicht; aber ein leiser Schmerz bleibt zurück. Er spricht für den Dichter Raoul Schrott.
Raoul Schrott: "Tropen. Über das Erhabene." Carl Hanser Verlag, München und Wien 1998. 211 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Poesie kommt hier mit einer Macht angerauscht, daß hier die Wände des Weltgebäudes zittern." Peter Michalzik, Süddeutsche Zeitung, 5./6.12.98 "Raoul Schrott bringt Dinge zum Sprechen. Mehr kann Poesie nicht leisten." Thomas Kraft, Tageszeitung, 07.10.98 "Raoul Schrott hat ein faszinierendes Vermögen, sich fremde Sprachen anzuverwandeln... Hier zeigt sich das Gespür Schrotts für das Interessante, Verdichtete, für die Möglichkeiten des poetisch Unwägbaren... ein schwindelerregender Jongleur.... Es ist faszinierend, wie ihm die Worte zufallen, wie er eine Balance aufbaut zwischen Sehnsucht und Vergeblichkeit... Raoul Schrott ist offenkundig der begabteste und virtuoseste Modernisierer in der gegenwärtigen deutschsprachigen Lyrik." Helmut Böttiger, Frankfurter Rundschau, 06.02.99