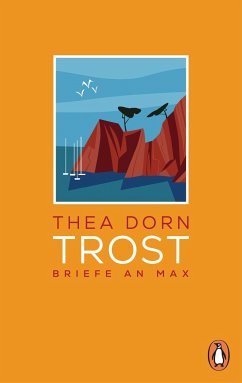Das Buch der Stunde für alle Untröstlichen
»Wie geht es Dir?« Als Johanna von Max, ihrem alten philosophischen Lehrer, eine Postkarte mit dieser scheinbar harmlosen Frage erhält, bricht es aus ihr hervor: die Trauer über den Tod ihrer Mutter, die Wut, dass man ihr im Krankenhaus verwehrt hat, die Sterbende zu begleiten. Provoziert durch weitere Postkarten, beginnt Johanna, sich den Dämonen hinter ihrer Verzweiflung zu stellen.
In einem einzigartigen Postkarten-Briefroman erzählt die Literatin und Philosophin Thea Dorn von den vielleicht größten Themen, die der gottferne, von seinen technologischen Möglichkeiten berauschte Mensch verdrängt: von der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, von der Suche nach Trost in trostlosen Zeiten.
Ausstattung: durchg. 4c
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
»Wie geht es Dir?« Als Johanna von Max, ihrem alten philosophischen Lehrer, eine Postkarte mit dieser scheinbar harmlosen Frage erhält, bricht es aus ihr hervor: die Trauer über den Tod ihrer Mutter, die Wut, dass man ihr im Krankenhaus verwehrt hat, die Sterbende zu begleiten. Provoziert durch weitere Postkarten, beginnt Johanna, sich den Dämonen hinter ihrer Verzweiflung zu stellen.
In einem einzigartigen Postkarten-Briefroman erzählt die Literatin und Philosophin Thea Dorn von den vielleicht größten Themen, die der gottferne, von seinen technologischen Möglichkeiten berauschte Mensch verdrängt: von der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, von der Suche nach Trost in trostlosen Zeiten.
Ausstattung: durchg. 4c
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Anders als es der Titel verspricht, bekommt Rezensent Carsten Hueck von Thea Dorn hier zunächst 170 Seiten "grelle Wut". Die Geschichte um die Redakteurin Johanna, deren Mutter in der ersten Corona-Welle nach einem Italien-Urlaub alleine im Krankenhaus unter Quarantäne stirbt und unter entsprechenden Bedingungen beigesetzt wird, ist schnell erzählt, meint der Kritiker. Dorns bissige, in Briefform verpackte Gesellschaftskritik an "Hygienehirten" und "Seuchenrittmeistern", trägt das Buch allerdings, fährt Hueck fort. Und so liest er in dieser Mischung aus "Polemik, Philosophie und Pamphlet" sehr differenziert vom Umgang mit der Pandemie und der krankhaften Vermeidung von Tod in unserer Gesellschaft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Thea Dorns Roman "Trost" bietet Anlass zu einer Frage: Wann wird Schreckliches Stoff für die Kunst?
Von Johannes Franzen
Daniel Mendelsohn schildert in einem Essay über den 11. September im Film eine interessante Episode der griechischen Kulturgeschichte. Der Dichter Phrynichos war zu Beginn des fünften Jahrhunderts vor Christus zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er in seiner Tragödie "Die Einnahme von Milet" das Trauma der Zerstörung der Stadt Milet durch die Perser wenige Jahre zuvor verarbeitet hatte. Das kam offenbar bedeutend zu früh, denn die Aufführung löste im Publikum einen Anfall schmerzhafter Trauer aus. Das Stück wurde für immer verboten.
Es existiert, das zeigt die Geschichte um den glücklosen Phrynichos, ein kulturelles Bedürfnis nach einer Schonfrist, was die Verarbeitung von kollektiven Traumata in der Kunst angeht. Mendelsohn nutzte das antike Beispiel, um die Frage zu stellen, welche ästhetischen Mittel im Jahr 2006 angemessen sein konnten, um den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon gerecht zu werden. Die zeitliche Nähe zu den fiktionalisierten Ereignissen stellt das Erzählen der Gegenwart vor besondere Herausforderungen. Müssen etwa, wie Mendelsohns Beispiele nahelegen, "United 93" von Paul Greengrass und "World Trade Center" von Oliver Stone, Spielfilme über eine Katastrophe einen besonders ernsten, quasi-dokumentarischen Charakter aufweisen, um zu zeigen, dass es sich nicht um reine Unterhaltung handelt?
Ähnliche Fragen nach dem Zusammenhang von Ethik und Ästhetik wirft die Covid-19-Pandemie auf. Im Oktober 2020 erschien der Trailer für einen Film mit dem unschuldig klingenden Titel "Songbird", der sogleich für laute öffentliche Irritation sorgte. Die Prämisse des hochkarätig besetzten dystopischen Thrillers lautete: Wir befinden uns im Jahr 2024. Die Pandemie ist inzwischen in ein neues, bedeutend tödlicheres Stadium (Covid-23) übergegangen. Menschen werden verpflichtet, mit ihren Mobiltelefonen tägliche Fiebertests zu machen, und wer diesen Test nicht besteht, wird zwangsweise in höllischen Q-Zones interniert. Vor dem Hintergrund dieses Szenarios entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Menschen.
Schnellschuss aus Angstlust
Es ist kaum verwunderlich, dass die Ankündigung des Films für Empörung sorgte. Das liegt zunächst an der Verantwortungslosigkeit, mit der ein Szenario, das den Fieberträumen eines rechtsradikalen Querdenkers entsprungen sein könnte, als Vorlage für einen unterhaltenden Genrefilm verwendet wird. Hier stellt sich die Frage nach den negativen Folgen der Fiktionalisierung von Zeitgeschichte. In diesem Fall scheint die kommerziell verlässliche Angstlust, die bestimmte Genres befriedigen, mit einem Gegenwartsbezug verbunden, der politische Ressentiments zu verstärken droht.
Die kunstsoziologische Frage, die sich daran anschließt, lautet: Gibt es implizite Regeln, von wann an es erlaubt ist, reales Leiden zum Spielmaterial der Künste zu machen? Ob Exploitation als ästhetisches Verfahren für einen Skandal sorgt, ist offensichtlich eine Kontextfrage. Je nach Zeitpunkt und politischer Bedeutung eines Gegenstandes scheint es zulässig, mit ihm zu spielen; oder es entsteht der Eindruck, dass die Frivolität der gewünschten Effekte - Spannung und Grusel - in einem unerträglichen Widerspruch zum immer noch frischen Bewusstsein der Katastrophe stehen. Es wird sicher einmal eine Zeit geben, in der die Pandemie als Material für teuer produzierte Genreerzählungen herhalten kann, sie ist aber noch in weiter Ferne.
"Songbird" wurde schlecht besprochen und wird wohl als Kuriosum eines geschmacklosen Schnellschusses in die Kulturgeschichte der Pandemie eingehen. Es handelt sich allerdings auch um einen Testfall für die ethischen Probleme, die mit Verarbeitungen der Katastrophe einhergehen. Nicht umsonst herrscht eine gewisse Beklommenheit beim Gedanken an all die Corona-Romane, Corona-Filme, Corona-Theaterstücke, die demnächst wie ein Gewitter auf uns herniedergehen werden. Was nämlich noch aussteht, ist ein grundsätzliches Nachdenken darüber, wann und wie es ethisch vertretbar und ästhetisch interessant sein könnte, aus dem Trauma Fiktion werden zu lassen.
Ein gutes Beispiel dafür, dass ein solches Nachdenken noch nicht stattgefunden hat, ist der gerade bei Penguin erschienene Roman "Trost. Briefe an Max" von Thea Dorn. In diesem schlanken Text verarbeitet eine Erzählerin namens Johanna ihre Wut und Verzweiflung über den Tod ihrer Mutter, die an Covid-19 gestorben ist. Bei der Lektüre des Buches möchte man einerseits die Geschwindigkeit bewundern, mit der aus einer Weltkatastrophe 176 Seiten Prosa destilliert wurden, andererseits werden auch die Gefahren des Schnellschreibens unmittelbar augenfällig.
Die Erzählerin ist Kulturjournalistin, und ein Großteil des Textes besteht aus ihren Briefen an ihren ehemaligen Philosophiedozenten Max. Damit ist ein Szenario entworfen, das es auf der Handlungsebene ermöglicht, die Erzählerin hemmungslos herumphilosophieren zu lassen. Schnell wird deutlich, dass es sich hier um ein Lieblingsgenre der deutschen Literatur handelt, den Leitartikel im Gewand der Rollenprosa. Der Roman dient als Vehikel für den ungeordneten Meinungswust der Autorin, die Fortsetzung des Debattenfeuilletons mit anderen Mitteln. Und weil man sich ja im Schutzraum der Fiktion befindet, kann man natürlich auch über die Stränge schlagen. Da ist dann die Rede davon, dass "Mutti Staat" aus Angst, ihr "aufgeseuchtes Völkchen" könne doch auf die Barrikaden gehen, "aus allen Geldkanonen schießt".
Leserbriefe an den Professor
Dergleichen Leserbriefpolemik durchwirkt den ganzen Roman (etwa im Geschimpfe über "Ökojakobiner"). Zudem wird allerlei Bildungsballast ungeordnet in die Erzählung abgeworfen (unter anderem: Sokrates, Platon, Seneca, die Stoa, Gryphius, Eichendorff, Hofmannsthal, Nietzsche). Der rasch geschriebene Zeitroman, der ein Szenario, das unzählige wirkliche Menschen katastrophal trifft, zur Verbreitung von Weisheiten über die Weltlage nutzt, erscheint nicht nur ethisch unangemessen, sondern erzeugt auch hohe ästhetische Kosten. Die krisenhafte Gegenwart setzt den Roman auch als Gattung unter Druck. Dorns Erzählung fällt es schmerzhaft schwer, von irgendetwas anderem zu handeln als von der Katastrophe. Es handelt sich um ein Buch, das allein zum Vergnügen der Menschen geschrieben wurde, die mit der Autorin schon vor der Lektüre einer Meinung waren.
Die Gegenwartsnähe drängt diese Fiktionen immerzu ins Thesenhafte, alles Stoffliche wird von der Meinungsmaschine des Textes verhackstückt. Sollte eine Verlusterfahrung bei der Verarbeitung in einem Roman nicht gerade dann universell (und tröstlich) wirken, wenn sie in ihrer ganzen emotionalen Konkretion dargestellt wird, als echtes menschliches Schicksal? Hier erscheint sie seltsam gedämpft, denn die individuelle Katastrophe wird von vornherein in den Dienst des diagnostischen Sprechens gestellt. Seltsam mitleidlos und flapsig geht die Erzählerin über das Grauen hinweg, gerade dort, wo dessen Wirklichkeit beschworen wird: "Diese Toten, die sich in Norditalien in den Krankenhauskellern stapeln, sind kein Sensationsgesums. Die gibt es wirklich."
Diese plumpe, gestammelte Versicherung könnte ein Moment raffinierter Erzählkunst sein, wenn sie einer gebrochenen Erzählerin in den Mund gelegt worden wäre. Wir würden dann Zeugen eines Versuchs, durch aufgesetzte Härte oder einen manischen Meinungsschwall das individuelle Erschrecken zu domestizieren. Es gehört aber zur Tragik des Thesenromans, dass er auf die Identifikation mit der Sprecherinstanz angewiesen ist. Das heißt: Selbst da, wo Johanna als schwache oder fehlbare Figur erscheinen soll, bleibt sie gespenstisch ungebrochen, weil sie sonst ihre Funktion als Meinungsvehikel nicht erfüllen könnte.
Eine solche Meinungsüberschussproduktion sorgte schon im ersten Jahr der Pandemie für einige Irritation, als professionelle Geistesarbeiter wie Giorgio Agamben oder Slavoj Zizek sie im Genre der Abhandlung praktizierten. Ebenso unausweichlich wie diese Corona-Philosophie ist eine Corona-Kunst, auf die Dorns Roman einen Vorgeschmack gibt.
Daniel Mendelsohn kam 2015 auf den tragisch gescheiterten Tragiker Phrynichos zurück, als er Ava DuVernays Film "Selma" rezensierte, der exakt fünfzig Jahre nach den blutig niedergeschlagenen Demonstrationen für das Wahlrecht der Schwarzen in die Kinos kam. Wenn die Geschichte des Phrynichos eine Lektion enthält, dann wäre jetzt erst einmal die Zeit des intellektuellen Innehaltens und des Nachdenkens darüber, wie der kollektive Schrecken verarbeitet werden könnte. Allerdings handelt sich wohl um eine vergebliche Hoffnung. Gerade erreicht uns die Nachricht, dass Juli Zehs neuer Roman "Über Menschen", der noch im März erscheinen soll, von einer Frau handelt, die vor dem Lockdown aufs Land flieht. Die Gegenwart bekommt keinen Aufschub.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Richtig gute Literatur ist immer auch Philosophie mit erzählerischen Mitteln - und das gelingt Thea Dorn in Trost. Ein anrührender Briefroman und eine Auseinandersetzung mit den großen Fragen unserer Zeit.« Juli Zeh