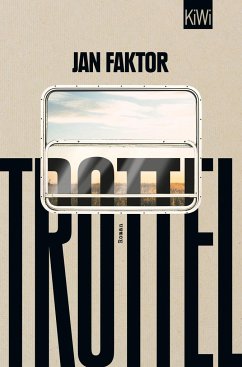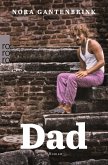Von der Prager Vorhölle, einer schicksalhaften Ohnmacht, einem Sprung und dem seltsamen Trost von Chicorée. Mit »Trottel« ist Jan Faktor ein funkelnder, anarchischer, ein großer Roman gelungen.
Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, Trottel - und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. So durchzieht diesen Rückblick auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird.
Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er groteske Erfahrungen mit der Liebe und übersiedelt nach einer Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, nach Ostberlin, taucht ein in die Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR und wird später auch noch vom Mauerfallüberrascht.
Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, Trottel - und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. So durchzieht diesen Rückblick auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird.
Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er groteske Erfahrungen mit der Liebe und übersiedelt nach einer Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, nach Ostberlin, taucht ein in die Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR und wird später auch noch vom Mauerfallüberrascht.

Die Einwände gegen sich selbst liefert dieser grandiose Roman schon mit: Heute erscheint Jan Faktors tieftrauriges Schelmenstück "Trottel".
Eine der vielen Hängebrücken, über die man beim Rezensieren von Büchern torkeln muss, ohne in den Abgrund aus Floskeln und Maschen zu fallen, ist die Hängebrücke hinein in den Text. Womit fängt man an? Mit einer Kostprobe aus dem Werk? Mit einem später zu begründenden Urteil? Mit einer Anekdote über den Autor? Mit einem originellen Vergleich?
Jan Faktor hat in seinem neuen Buch an die Nöte seiner Rezensenten gedacht. Bereits im Buchdeckel befinden sich "Anregungen und Vorschläge" für Berufskritiker. Und sie bringen die Sache auf den Punkt. Dass dieser Roman eine Liebeserklärung an die alte, verschlafene DDR sei, aber gleichzeitig voller Abscheu: "Das passt leider nicht wirklich zusammen." Dass man den Autor nach der Lektüre seines Romans strafen müsste: "Für jede seiner vielen Fußnoten verdient dieser Mensch einen Stromschlag angemessener Stärke und Spannung." Dass das Buch zwar "kenntnisreich geschrieben" sei und sogar "exzellent recherchiert", leider aber "teilweise trotzdem voller Schwachsinn". Viel Verwirrung würden vor allem "die zu Hunderten in den Fußnoten untergebrachten Detailinformationen" stiften. Ach ja, und ganz wichtig: "Kann es gut gehen, wenn einer ein höchst albernes Buch über den Tod seines eigenen Sohnes zusammenstoppelt? Das Antwortwort heiße eindeutig Nein!"
Nun wäre das Urteil gefällt: Der "Trottel" ist missraten! Das allerdings so grundsätzlich, dass jetzt die eigentliche Arbeit beginnen kann. Die Besprechung eines Romans, für den sich Jan Faktor zwölf Jahre Zeit gelassen hat. 2010 war er mit seinem autobiographischen Schelmenroman über eine Jugend im Prag der Nachkriegszeit für den Deutschen Buchpreis nominiert. "Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag" war der Titel dieses komischen Werks, das dem literarischen Außenseiter Faktor viel Bewunderung einbrachte. Danach sprengte ein Ereignis das Leben des Autors. Sein Sohn nahm sich mit Anfang dreißig das Leben. "Trottel" ist der zum Scheitern verurteilte Versuch, einen Ausdruck für diesen Verlust zu finden.
"Zum Scheitern verurteilt" soll hier kein läppisches Kritikerurteil sein, sondern nur die Unmöglichkeit benennen, für etwas Maßloses ein Maß zu finden, in dem es gewogen und dargestellt werden kann. So mag es den einen oder anderen, vielleicht sogar den Autor selbst, befremden, dass dies ein überaus heiteres Buch geworden ist. Jedenfalls keines, das den Verlust metaphysisch reflektiert und dabei den Schmerz in den Vordergrund stellt. Eher eines, das sich erinnert an das geführte Leben und dessen viele Irrtümer.
Indem Jan Faktor von der Geburt, dem Aufwachsen und schließlich dem Krankwerden seines einzigen Sohns schreibt, erzählt er sich selbst im Kontext seines Umfeldes, das er 1978 mit seiner Übersiedlung nach Ostberlin zu seiner späteren Frau, einer Tochter von Christa Wolf, betritt ("etwas in mir wollte aus Prag verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfilzten, porenverstopften Knödelgeschwulst") und sogleich ethnographisch erforscht. Dabei ist alles, was er sieht, von gargantuesker Fülle - sogar im notorischen Mangel: blühende Phantasielandschaften. "Die DDR war einfach ein Musterland, sie war glänzend verrottet, tiefst im Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg."
Zum Glück gibt es den literarischen Prenzlauer Berg, in dem zwar auch alles verrottet ist, aber den Kommune-2-Glamour einer "linken Hölle" aufweist, wo sich alles versammelt, was abseits der Parteidoktrin denkt: "Aus dem Kreis gefielen mir sowieso die beeindruckend sorgenfrei lebenden Aussteiger am besten - und bei denen war es mir wirklich egal, ob ich sie Kryptoanarchisten, Eurokommunismusapostel oder nur Chaoten nennen wollte." Die ausreichende Anwesenheit libertinärer Frauen macht den linken Debattierklub auch zu einer Lebensstilexperimentierbude frei nach dem Motto: "Lieber ran an die Gebärmutter der menschlichen Erfahrung!" Kurzum: "Für mich bildete der Prenzlauer Berg eindeutig den städtischen Mittelpunkt und hatte in meinen Augen, trotz des hohen Zerfallgrads, etwas Majestätisches. Die darunterliegenden Stadtgebiete wirkten auf mich größtenteils wie unglücklicherweise geerbte, aber de facto aufgegebene Flächenrelikte, die nach der Teilung der Stadt keine besondere Rollte mehr spielten."
"Trottel" ist ein Roman nicht nur mit vielen Fußnoten, meist zu Realien des sozialistischen Alltags, sondern auch mit vielen Gesichtern: Es ist ein Soziogramm der Prenzlauer-Berg-Intelligenzija, ein Ehe- sowie ein Vater-Sohn-Roman. Nebenbei außerdem die äußerst unterhaltsame talking cure eines jüdischen Tschechen, der in Ostberlin versucht, sowohl die Häscher seiner Vorfahren ("transgenerationell unterbemittelt") als auch die bösen Geister des tschechoslowakischen "Panzer-Sozialismus" loszuwerden. Dieser Tscheche in Deutschland "mit ein bisschen Auschwitzschrecken im Nacken" kämpft sich nach jahrelanger Schreiblähmung zurück ins Leben. Mit beeindruckendem élan vital berichtet er in "Trottel" auch immer wieder von seinem Sohn, der bereits als Kleinkind mit unheimlichen Ticks wie ruckartigem Lufteinsaugen auffällt und sehr früh aus den Bahnen des "Normalen" ausschert, was schließlich im Ausbruch einer Psychose mündet.
Bei all dem geht Jan Faktor keineswegs strukturiert vor, sondern folgt einem aus der Psychoanalyse bekannten Assoziationsprinzip, das man als pseudotrottelig bezeichnen könnte und dem Lektor Sorgen bereitete, wie wir aus dem Roman selbst erfahren: "Mein Lektor Jan Moritz rät mir, mit dem Kapitel an dieser Stelle Schluss zu machen und vor allem keine weiter oben verwendeten Lexeme wie Mauer, Durchbruch, Seitenflügel, Labyrinth, Dietrich, Rohrleitung, Wanze nochmal aufzugreifen - und schon gar nicht Reizwörter wie Busen, Bauch, Schulter, Nippel, Schenkel, Hügel, Schlitz und so weiter zu verwenden."
Doch dieser Autor ist unbeirrbar und unbelehrbar sowieso. Natürlich werden alle Fußnoten, Anmerkungen des Lektorats und vermeintlichen Einwände der Kritik entweder direkt in den Text kopiert oder an Ort und Stelle erörtert. So folgt man in mäandrierender Rhythmik den hakenschlagenden Exkursen in eine Welt, die heute museal wirkt: entweder nostalgisch verklärt von Dabeigewesenen oder durch Westkolonisation miniaturisiert - jedenfalls kulturell possierlich.
Bei Jan Faktor wird die DDR jener Jahre auf liebevoll ketzerische Weise wiederbelebt und dabei noch einmal begraben: "Technik und Liebe, Zwang und Zärtlichkeit, Didaktik und Kollektivismus, Mangel und Großmut, Infantilisierung und Vulkanisierung, Erwachsenenerziehungsmaßnahmen und sanfte Schläge auf den Hinterkopf - dies alles bildete im DDR-Alltag eine beeindruckende und von der Allgemeinheit meist auch akzeptierte Einheit."
So ist dieses tragikomische Buch, ganz wie vom Autor prognostiziert, "ein Mund voller schussbereiter Spucke". Die neue "Filinchen-Heimat" unseres Tschechen wird in "Trottel" zum surrealen Sozialismus mit mal menschlichem, mal unmenschlichem Antlitz: "So war es damals im Sozialismus: einer für alle, alle für niemanden und schon gar niemand für das leere Nichts."
Der Trottel ist bei alldem doch ein proletarischer Bruder des weltliterarisch aufgeplusterten Schelms. Ein Jedermann, dessen Leben von Zufällen und naiven Abenteuern geprägt ist, der zwar immer wieder auf die Füße fällt, aber dabei immer auf den Teppich. Ein Mensch, der keinen Plan verfolgt und dessen Leben deswegen genug Stoff für zehn Romane abwirft. Wie sagte einst die jüdische Großmutter des Erzählers, die mehr als ein Konzentrationslager überlebt hatte, zu ihrem Enkel? "Auch wenn es dir im Leben sonst wie dreckig gehen sollte, merke dir: Aus jeder Kacke lässt sich eine gute Suppe kochen." KATHARINA TEUTSCH
Jan Faktor: "Trottel". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020. 397 S., geb. 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Jörg Magenau empfiehlt Jan Faktors Roman als Mittel gegen Schmerzen aller Art. Allerdings muss der Leser Faktors Strategie begreifen. Dabei handelt es sich laut Magenau um einen alles und jeden "zersetzenden Humor", eine Komik, mit der der Erzähler-Trottel den Tod des Sohnes, die jüdische Herkunft und allerhand "Schmerzspuren" noch zu überwinden sucht. Das erinnernde, abschweifende Dauergelaber und die hemmungslose Kalauerei des Erzählers lassen sich mit diesem Wissen gleich viel besser ertragen, meint Magenau.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»ein Roman, der dem Leser zwinkernd den Stinkefinger zeigt [...] bedrückend und liebevoll zugleich« Christoph Woldt neues deutschland 20230117