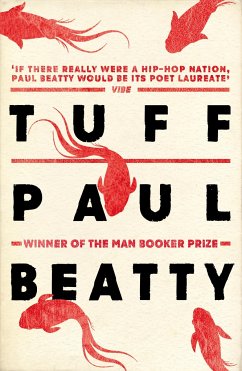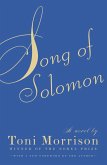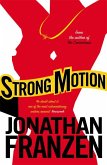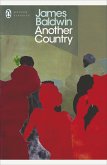Paul Beatty versucht sich an einer brutalen Satire
Was ist eigentlich ein Krimi? Man könnte Lexikon-Definitionen bemühen, sich gut informiert fühlen, dann an einen Autor wie Paul Beatty geraten - und schon ist die angelesene Checkliste ungültig. Sein im Original bereits 2000 erschienenes Buch "Tuff" ist auch Kriminalliteratur. Im Wesentlichen handelt es sich dabei aber um einen erzählerischen Gemischtwarenladen, der jenes Publikum anspricht, das sich nicht an Genres klammert, sondern vor allem Interesse an sprachlicher Finesse mitbringt.
Der Protagonist Winston "Tuff" Foshay sagt einmal: "'Hip-Hop-Szene'. Wo ist denn dann bitte die Opern-Szene? Die Heavy-Metal-Szene? Scheiße, wie soll man die Leute denn nach ihren Musikvorlieben definieren?" Man wird ergänzend fragen dürfen, wie man die Leute nach ihren Literaturvorlieben definieren soll. Am besten gar nicht, also Genre-Regeln über Bord und los.
Zu Beginn ist alles Thriller as usual: Brooklyn, New York. Schießerei. Winston - zweiundzwanzig Jahre, hundertfünfzig Kilo, frischgebackener Vater, kleinkriminell, sympathisch und zugleich unsympathisch - erwacht in einer zur Drogenküche umfunktionierten Wohnung. Drei Leichen auf dem Boden, hier sämiges Blut, dort Hirnmasse. Er trifft einen Freund und verlässt mit ihm den Tatort. Die Bilder des Schlachtfests "flackerten in seinem Kopf auf wie Dias im Biologieunterricht". Er schließt die Augen und zählt alle Toten, die er bislang gesehen hat: sechzehn Stück. Zu viele. Damit sein Leben eine Richtung bekommt, entschließt er sich, für den Stadtrat zu kandidieren.
Der Plot durchläuft mehrere Metamorphosen. Beatty erzählt die Liebesgeschichte von Winston und seiner Frau Yolanda in einer rührenden, sich langsam entfaltenden Rückblende, um sie direkt mit einer klassischen Konfliktszene kurzzuschließen: Der betrunkene Mann kommt zu spät heim, wo Frau (wütend) und Kind (putzig) schon lange auf ihn warten. Dann wieder tragen schnelle, witzige Dialoge die streckenweise kammerspielhaft reduzierte Handlung.
Zu Winstons Entourage gehören sein antisemitischer Freund Fariq, der sich die meiste Zeit Gedanken darüber macht, wie man am besten reich wird. Sein Mentor Spencer, ein schwarzer Rabbiner, der aus Liebe zu einer Frau, die längst über alle Berge ist, zum Judentum konvertierte. Seine mütterliche Freundin Inez, eine linke Revoluzzerin mit bewegter Vergangenheit. Und sein Vater, ehemaliger Black Panther, der sich als Dichter versucht und Lesungen beginnt, indem er Salven in die Luft feuert: "Bämm! 'Das ist für die Vergewaltigung meiner Urgroßmutter.' Bämm! 'Und die soll uns ans Herz wachsen.' Es regnete Deckenputz und Spanplattenteile. Das Publikum saß auf der Stuhlkante."
Das klingt wild, das ist wild. Und wenn schon "Krimi" nicht das passende Label für dieses Buch darstellt, dann wäre zumindest "Satire" eine gute Wahl. So wird der junge, schwarze, abgehängte Mann in Amerikas Metropolen zweifach thematisiert: zum einen als Karikatur, zum anderen als Figur, die sich aufgrund der sozialen und politischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten überhaupt erst karikieren lässt. Beatty, Jahrgang 1962 und einer der wichtigsten afroamerikanischen Poetry-Slammer der Neunziger, kann auf diese Weise moralische Kommentare in den Plot schmuggeln, ohne als Tugendbold aufzutreten.
Sein ganzes Potential entfaltet das Buch nur im englischsprachigen Original. Der Übersetzer Robin Detje gibt zwar alles, kriegt Beattys spezielle Mischung aus Hip-Hop-Jargon und reflektiertem Parlando aber nicht zu fassen: Insgesamt wird geflucht und überzeichnet, was das Zeug hält. Die Figuren können gleichwohl auch auf ausgesprochen eloquente Weise ausgesprochen kluge Dinge von sich geben.
Einerseits umschifft der Autor damit die Klischee-Falle, andererseits hält der Roman so Distanz zum Leser. Die Charaktere atmen nicht, sie erfüllen Rollen. Insofern fragt sich, was gewonnen ist, wenn das Abziehbild des Afroamerikaners vermieden wird, Winston dafür jedoch in einer grotesk-slapstickhaften Szene den Hund eines Polizisten erschießt? Die Antwort immerhin: Komik. KAI SPANKE
Paul Beatty: "Tuff". Roman.
Aus dem Englischen von Robin Detje. Btb Verlag,
München 2022.
448 S., br., 12,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main