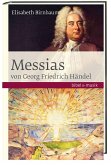Zum 250. Todesjahr von Georg Friedrich Händel - ein großer erzählerischer Essay von Karl-Heinz Ott. Die Oper, London, Kastraten und Diven prägen Händels Welt, aber auch Philosophen, die über der Frage, ob man die Theater verbieten solle, zu Erzfeinden werden. Dieses so kluge wie unterhaltsame Buch über den bedeutenden Komponisten rückt die Musik des 18. Jahrhunderts in den Blick und handelt dabei auch von unserer Gegenwart.
Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott hat lange als Operndramaturg gearbeitet und zahlreiche Essays über Musik veröffentlicht. Mit seinem Händel-Buch eröffnet er auch dem Laien eine Welt, die über das rein Musikalische weit hinausweist. Er führt nicht nur vor, wie eng musikalische Ausdrucksmittel, geschichtliche Entwicklungen und philosophische Grundsatzfragen miteinander zusammenhängen, sondern beweist vor allem, dass sich profundes Wissen auch mitreißend vermitteln lässt. Wer das 18. Jahrhundert Georg Friedrich Händels erkunden will, sieht sich unversehens mit dem Heute konfrontiert. Und sei es nur, dass man sich fragt, warum Barockmusik seit einiger Zeit nicht mehr so langweilig wie noch vor fünfzig Jahren klingt und was das mit unserer Vorstellung von Musik zu tun hat.
Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott hat lange als Operndramaturg gearbeitet und zahlreiche Essays über Musik veröffentlicht. Mit seinem Händel-Buch eröffnet er auch dem Laien eine Welt, die über das rein Musikalische weit hinausweist. Er führt nicht nur vor, wie eng musikalische Ausdrucksmittel, geschichtliche Entwicklungen und philosophische Grundsatzfragen miteinander zusammenhängen, sondern beweist vor allem, dass sich profundes Wissen auch mitreißend vermitteln lässt. Wer das 18. Jahrhundert Georg Friedrich Händels erkunden will, sieht sich unversehens mit dem Heute konfrontiert. Und sei es nur, dass man sich fragt, warum Barockmusik seit einiger Zeit nicht mehr so langweilig wie noch vor fünfzig Jahren klingt und was das mit unserer Vorstellung von Musik zu tun hat.

Das Werk ruft: Was man zum Jubiläum lesen, sehen, hören muss. Und was lieber nicht
Karl-Heinz Otts Buch kennt nur zwei Bösewichte: Adorno und Adornos Bach. Ein Missverständnis.
Bis jetzt liegen elf neue Händelbücher zum Händelgedenkjahr auf dem Tisch. Nicht zu viele, verglichen mit der Kiste Mozartbücher vom Mozartjahr. Aber wie im mozartschen, so gibt es auch in Händels Lebensroman mehr blinde Flecken als zuverlässige Fakten.
Geboren, gestorben, gereist von hier nach da, gelernt bei diesem und jenem. Dazu kommen drei oder vier Anekdoten, die bereits ein Jahr nach Händels Tod vom Reverend John Mainwaring zusammengetragen worden waren für seine "Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel" (London 1760) - die erste Musikerbiographie der Musikgeschichte überhaupt, ein Büchlein, von dem sich alle weiteren Händelbiographien seither nährten und das, übersetzt, ergänzt, kommentiert, nie ganz vergriffen war. Zurzeit kann man den Mainwaring als Faksimile-Edition bei Travis & Emerey Music Books bekommen (über den JPC-Versandhandel im Sonderangebot für 15,72 Euro). Wer sich dazu gleich auch noch die "Alcina"-Arien-CD mit Christine Schäfer bestellt (Cavi-Music, bei JPC 14,99 Euro), der hat für kleines Geld schon die wichtigsten Devotionalien des Händeljahres beisammen. Womit keineswegs gemeint ist: den ganzen Händel.
Georg Friedrich Händels Werk ist riesig. Die Hallische Händel-Gesamtausgabe, begonnen Anfang der Fünfziger, soll 2023 abgeschlossen sein. Bis heute wird aber immer noch nur eine Handvoll Händelmusik gespielt, immer wieder dieselben Stücke: Hallelujah, Sarabande, Largo, Einzug der Königin von Saba, Wassermusik, Cesare, Alcina, Rodelinda. Gerade in den letzten Jahren sind einige weitere Opern wieder ausgegraben worden, noch immer gäbe es viel zu entdecken. Insofern bilden Mainwaring auf der einen, Schäfer auf der anderen Seite die Eckpfeiler nicht nur für das aktuelle Händelbild, sondern auch für die virulente Barockmusikdebatte. So authentisch nämlich Mainwarings Bericht sein mag - seine Ansichten über die Musik bleiben in der Händelzeit stecken, aus der sie stammen. Schäfer aber singt, worüber sich die Puristen unter den Freunden geläufiger Koloraturen pünktlich wieder aufgeregt haben, keineswegs stilecht auf der Höhe heutiger historischer Aufführungspraxis, sondern so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist: stürmisch, intensiv, persönlich. Und stellt damit die einzig brennende Frage, um die sich zehn der elf Händelbücher dann doch lieber wieder herumdrücken: Warum fasst uns ausgerechnet diese Musik heute so stark an?
Woher der Barockopernboom? Wie kommt es zu dieser wundersamen Vermehrung von Händelopern in den Spielplänen deutscher Stadttheater, mit oder ohne Countertenöre, mit oder ohne Kerzenlicht? Inwiefern passt eine italienische Seria-Oper mit perlenkettenfunkelnden Dacapoarien so gut zum Zeitgeist des 21. Jahrhunderts, dem "spirit of our times", wie der Dirigent Alan Curtis es strahlend behauptet in "Händel - Der Film"?
Bei dieser NDR-Produktion aus dem royalmottenkistenbewährten Hause Seelmann-Eggebert, die am Ostersonntag erstausgestrahlt wird, handelt es sich um eine Softdoku, darin aktuelle Straßenbilder aus Swinging London mit perückensatten Spielfilmsequenzen gekreuzt werden. Auch dass der Schauspieler, der für die Rolle des jungen Händel gecastet wurde, Simon Rattle verblüffend ähnlich sieht, suggeriert Gegenwartsbezug. Und eine Barbiepuppenstimme aus dem Off beharrt darauf, dass Händel der "erste Pop-Titan" der Geschichte gewesen sei; er habe "Hits für die Ewigkeit" geschrieben, es sei in seinen Opern um genau dieselben tollen Themen gegangen wie beispielsweise in "Desperate Housewifes" oder in den "Mystery"-Serien und was dergleichen amadeusmäßige PR-Poesie mehr ist. "His music is happy! happy! happy!", ruft beschwörend auch Händelfan Donna Leon. Aber weil sie dabei so streng in die Kamera blickt, dass auch die Happy-Händel-Tonspur des Films (Hallelujah, Sarabande, Königin von Saba etc.) nichts mehr herausreißen kann, zappen wir lieber schnell weiter.
Ein neues Händelbuch, heißt es, sei nun doch am Start, das uns Händel aus der Gegenwart erklärt und in die Gegenwart holt, "sachkundig" ("Berliner Zeitung") und "klug, von kleinen Schludrigkeiten abgesehen" ("Süddeutsche"): eine "jubelnde Liebeserklärung" (F.A.Z.) eines "wagelustigen" ("Zeit"-) Autors. Ja, fast hätte Karl-Heinz Ott für seinen Händel-Essay in acht Kapiteln "Tumult und Grazie" sogar den Leipziger Buchpreis bekommen.
Der Titel ist herrlich händelig. Gemahnt an den zauberhaften Seelenton von Händels Melodieerfindung in den langsamen Sätzen und an die Energieströme, die Sturmgebärden in den schnellen. Außerdem erinnert die Begriffsdialektik natürlich an Ivan Nagels berühmten Mozart-Aufsatz "Autonomie und Gnade" aus dem Jahr 1985, darin die starre Gattungspoetik von barocker Seria- und bürgerlicher Buffo-Oper erstmals relativiert wurde, was zur Folge hatte, dass auch Mozarts "Idomeneo" wieder auf den Bühnen auftauchte; aber auch auf Wolfgang Schlüters "Anmut und Gnade" verweist der Titel, einen Roman, der zurück zu Rameau zeitreist und zärtlich-gescheit die historischen Aufführungspraktiker zaust. Karl-Heinz Ott hat sich die Latte hoch gelegt.
Wir schlagen das Buch auf, lesen gleich auf der ersten Seite etwas von einer "schrillen Querflöte" und danach den aussageschlaffen Gummisatz: "Vor dreißig, vierzig Jahren war das alles noch anders, zumindest im Großen und Ganzen." Und denken uns: "Oh wie dumm!" Hier hat Ott, weil er ja offenbar den Gegensatz zwischen historischer Blockflöte und moderner Boehm-Querflöte beschreiben möchte, mit "schrill" nicht die Querflöte, sondern eine Pikkoloflöte gemeint und nicht bedacht, dass eine Blockflöte im Sopranino-Register genauso schrill klingt. Auch der Lektor hat nicht aufgepasst. So was kommt vor, Schwamm drüber.
Wir lesen weiter, lesen uns besoffen an hinkenden Bildern, stolpernden Metaphern, staunen über Verallgemeinerungen, Übertreibungen, Untertreibungen und Falschmeldungen, werden überrollt von Superlativlawinen und Füllwörtern, treffen auf atemlos eigenwillige Grammatiklösungen ("und zwar schon deshalb, damit"), bis wir schließlich (auf Seite 25) auf folgende Aussage treffen: "Die historische Spielweise zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass man die Myriaden von willkürlich hinzugefügten Artikulationsangaben vergessen muss, die den barocken Partituren erst später hinzugefügt wurden. Schließlich findet sich in ihnen von der Romantik an kein einziger Takt mehr, der nicht mit Phrasierungsbögen, Pedalvorschriften, Stakkatotupfern, Crescendo- und Decrescendo-Pfeilen, Forte- und Pianozeichen und sonst noch allerlei Humbug übersät worden ist."
Das ist nicht nur schwadronierendes Pausengeplauder, wichtigtuerisch, flüchtig; es ist nicht nur, zur Sache gesprochen, ein Blödsinn, in den man sich in der Hitze eines Debattengefechtes vielleicht mal hineinvergaloppieren kann. Wer dergestalt den Historismus des romantischen Zeitalters verketzert und dazu auch noch behauptet, Vortragsbezeichnungen in der Musik seien "ein Humbug", der hat entweder keine Ahnung von Musik, Literatur und Geschichte - oder er hat etwas mit uns vor: ein Demagoge.
Karl-Heinz Ott ist ein erfolgreicher Romanschriftsteller. Er ist auch ein studierter Musikwissenschaftler und Germanist, hat praktische Erfahrung als Operndramaturg. Wir denken uns deshalb an dieser Stelle: "Ott weiß es gewiss besser; warum textet er aber uns Leser so falsch zu? Ein dummes, gefährliches Buch!"
Jetzt haben wir das Buch ganz durchgelesen und nehmen diesen Satz wieder zurück. Gefährlich ist es nicht. Nur überschätzt, eitel und überflüssig. Im ersten Kapitel, das eine dithyrambische Ode in mehreren wiederholten Strophen singt auf die Vielfalt der Wahrheiten historischer Aufführungspraxis heutzutage, baut sich Ott zwei Pappkameraden auf, um sie anschließend wortreich zu verhauen. Der eine Gegner heißt Adorno, der andere heißt: Adornos Bachbild. Oder auch: Das historische Bachbild des 19. Jahrhunderts. Oder auch: Bach selbst - wie sich dann im zweiten Kapitel nahtlos herausstellt und in den folgenden händelbiographischen Kapiteln repetiert wird. Am Schluss rührt Ott die Begriffsdefinitionen des Barock um, an den Rockzipfeln von Gilles Deleuze und Benedetto Croce, bis auch davon nur ein großes, dampfendes Kompott übrig ist. Na gut. Nicht nur mit Datierungen, Musikzitaten, Ortsangaben, Gattungen, Namen nimmt es Ott nicht allzu genau, auch die Klischees, die er heraufzitiert, um sie wiederum mit neuen Klischees aus dem Weg zu schaffen, wechseln Habit, Hut und Farbe.
Die These, Johann Sebastian Bach habe hauptsächlich verzwirbelte Fugen geschrieben; und er habe, anders als der Theatermann Händel, "die irdische Liebe, oder anders gesagt: alles Sinnliche" zu wenig gekannt, vor allem aber nicht gespiegelt in seiner Musik, wird auch nicht richtig durch mehrfach variierte Wiederholung. Die historisch informierte Aufführungspraxis aber, für die Ott immer neu seine Don-Quijote-Lanze anspitzt, ist in der heutigen Musikpraxis schon lange die vorherrschende geworden: sie ist das "juste milieu". Wir hätten nur zu gern gewusst, wie es dazu kam und was es für uns und für den Zeitgeist bedeutet. Davon dann ein andermal.
ELEONORE BÜNING
Karl-Heinz Ott: "Tumult und Grazie. Über Georg Friedrich Händel". Hoffmann und Campe, 22 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Zwei neue Biografien des Komponisten Georg Friedrich Händel bespricht Hans-Jürgen Linke gleichermaßen wohlwollend, wobei er keinen Zweifel daran lässt, dass ihr Erscheinen zuvörderst Händels zweihundertsten Todestag zu verdanken ist. Denn die Kenntnise über den Komponisten sind noch immer so spärlich, dass sie allenfalls eine lebendige Skizze seines Lebensweges ergeben könnten. Karl-Heinz Otts Darstellung sieht Rezensent Linke denn auch weniger im Faktischen als im Essayistischen brillieren. Bereichert sieht sich Linke hierbei von musikhistorischen und kulturgeschichtlichen Reflexionen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Ein hinreißender Cicerone durch die Gedanken- und Gefühlswelt dieser Musik. « Frankfurter Allgemeine Zeitung