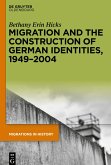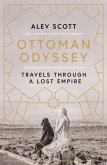The essays in this book are the first scholarly attempt to examine the complex interrelation of social change and political radicalization during the 1960s. In analyzing topics ranging from the 1968 student uprising, working class politics and trade unionism, Anti-Americanism, right-wing and left-wing militant action, communitarian violence, state coercion, and the artistic representation of these phenomena the contributors offer insights to help to answer why the experiences of this decade turned so radical with lasting polarizing effects on contemporary Turkish society today.
Even though issues surrounding the topic are at the very center of intellectual and political debates in today´s Turkey, such as the collective remembrance of the Turkish "68ers" and of the anti-communist state persecution and prosecution after the military intervention in 1980, a cohesive analysis of this era is still strikingly absent in scholarly works. Thus, "Turkey in Turmoil" is unique in many regards. As important as the presented diversity in research perspectives, the volume will also showcase multiple and, at some point, contesting and even provocative perspectives on the subject at hand.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Even though issues surrounding the topic are at the very center of intellectual and political debates in today´s Turkey, such as the collective remembrance of the Turkish "68ers" and of the anti-communist state persecution and prosecution after the military intervention in 1980, a cohesive analysis of this era is still strikingly absent in scholarly works. Thus, "Turkey in Turmoil" is unique in many regards. As important as the presented diversity in research perspectives, the volume will also showcase multiple and, at some point, contesting and even provocative perspectives on the subject at hand.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Neue Freiheit und neuer Radikalismus - die Türkei in den sechziger Jahren
Die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren das Jahrzehnt, in dem sich die Türkei mehr verändert hat als in jedem anderen, wenn man von den Jahren unmittelbar nach der Gründung der Republik absieht. Wer die Politik und die Gesellschaft der Türkei von heute verstehen will, findet dazu Antworten in den Jahren zwischen den Militärputschen von 1960 und 1971. Die Grundlagen für den Umbruch hatten die fünfziger Jahre mit dem Ende der Ein-Parteien-Herrschaft der von Atatürk gegründeten CHP und dem Beginn der Landflucht gelegt. Erst in den sechziger Jahren entfalteten sich der gesellschaftliche Wandel und die politische Radikalisierung mit einer Dynamik, die bis heute nachwirkt.
Über Jahrzehnte war die urbane republikanische Elite das Gesicht der Türkei. Mit der Landflucht veränderte sich das grundlegend. Sie machte auch die ländliche, anatolische Türkei sichtbar. Als die Städte wuchsen und mehr junge Menschen studierten, wurden die Universitäten zu Zentren linker Agitation; die Freiheiten, die die neue Verfassung von 1961 schuf, ermöglichte zudem erstmals Diskussionen über die Kurdenfrage; und der Kalte Krieg begünstigte das Entstehen einer gewaltbereiten Bewegung türkischer Nationalisten. Die Wucht dieser gegensätzlichen Kräfte entlud sich im Bürgerkrieg der siebziger Jahre, den erst ein weiterer Militärputsch 1980 beendet hat.
Wie dieser gesellschaftliche Wandel ablief und wie er zur politischen Radikalisierung beitrug, zeigen fünfzehn Beiträge international renommierter Historiker und Sozialwissenschaftler in einem Sammelband, den die an der Universität Duisburg-Essen forschende und lehrende Berna Pekesen herausgegeben hat. In einem Beitrag stellt der Soziologe Caglar Keyder die sechziger Jahre der Türkei in das Jahrzehnt des weltweiten Protests, der von Studenten getragen und durch den Vietnam-Krieg befeuert worden war.
In der Türkei war es jedoch in erster Linie die Landflucht, die die Machtverhältnisse nicht nur herausgefordert, sondern auch nachhaltig verändert hat. 1950 lebten noch 81 Prozent der Bevölkerung in Dörfern und Kleinstädten mit weniger als 10 000 Einwohnern, heute sind es weniger als zehn Prozent. Die größte Flut der Binnenmigration aus den anatolischen Dörfern an die Ränder der Großstädte ereignete sich in den sechziger Jahren, nicht wenige zogen anschließend weiter nach Deutschland. In der Türkei errichteten die Binnenmigranten am Rande der Städte auf öffentlichem Grund illegale Siedlungen. Im Laufe der Zeit wurden diese Gecekondus legalisiert.
Zeitweise waren in Ankara und Istanbul mehr als zwei Drittel der Einwohner anatolische Binnenmigranten, die sich in Gecekondus niedergelassen hatten. Weshalb sie keine Zentren linker Agitation wurden und in ihnen kein Proletariat heranwuchs, wird bei der Lektüre der Beiträge klar. Die Zugewanderten blieben weiter ihrem ländlichen Denken und Verhalten verhaftet. Sie wohnten am Rande der Stadt, wurden aber keine Städter. Denn die alte städtische Elite und ihre Partei, die CHP, blickten verächtlich auf sie herab. Konservative und vor allem islamisch gefärbte Parteien machten sich jedoch die Sache der Anatolier zu eigen.
Zudem setzte eine Industrialisierung ein, jedoch nur in kleinem Maßstab. Die meisten Bewohner der Gecekondus verdienten ihren Lebensunterhalt in der informellen Wirtschaft. Die neuen privaten Industriebetriebe waren aber groß genug, dass dort militante und politisierte linke Gewerkschaften entstanden und Streiks bald zum Alltag gehörten. Die Zahl der privaten Industriebetriebe hat sich in dem Jahrzehnt zwar auf mehr als 4500 versechsfacht. 1970 waren bei einer Bevölkerung von 35 Millionen aber lediglich 1,5 Millionen Industriearbeiter.
Die Universitäten, die mit der Verstädterung wuchsen, wurden ein wichtiger Ort der politischen Auseinandersetzung, aber auch ein Ort, an dem sich gewaltbereite nationalistische, linke und kurdische Organisationen blutige Auseinandersetzungen lieferten. Kurdische Studenten machten über das Forum, das sie an den Universitäten hatten, in den sechziger Jahren die lange ruhende Kurdenfrage wieder zu einem öffentlichen Thema. Zur Radikalisierung trug ferner bei, dass revolutionäre Aktivisten der alevitischen Minderheit, wie es Tahire Erman beschreibt, in Gecekondus "befreite Gebiete" ausgerufen und deren Bewohner "erzogen" haben. Mit ihrem egalitären, staatskritischen und damit linken Weltbild standen und stehen sie in einem Gegensatz zu den überwiegend konservativen sunnitischen Muslimen. Nur in einer derart aufgeladenen Stimmung waren in den siebziger Jahren die Straßenschlachten zwischen Angehörigen der ideologisch verfeindeten Lager möglich.
Dem Sammelband tut gut, dass die politischen und gesellschaftspolitischen Analysen durch Beiträge zur Kultur jenes Jahrzehnts abgerundet werden. Ob die republikanische Staatselite, die neue Linke oder die konservativen Bewohner der Gecekondus: Jeder hatte aus den türkischen Musiktraditionen andere Stile übernommen und weiterentwickelt.
Mehr als ein halbes Jahrhundert nach den sechziger Jahren ist der damals angestoßene demographische und gesellschaftliche Wandel nahezu abgeschlossen. Wo einst die ländlichen Gecekondus als Abbild des Lebens in Anatolien gestanden haben, sind moderne Wohnviertel einer neuen Mittelschicht entstanden. Erdogans Partei AKP konnte sich bislang auf die Stimmen aus diesen Vierteln verlassen. Aus den Anatoliern sind nun Städter geworden, ihre Bedürfnisse sind heute andere. Darauf hat die AKP aber noch keine Antwort, aus diesem Grund hat sie die Lokalwahlen vom Frühjahr 2019 verloren.
Andere Grundfragen, die die Türkei seit den sechziger Jahren prägen, zerreißen das Land weiter: Eine politische Lösung der Kurdenfrage ist noch immer nicht in Sicht, und während die militante Linke nahezu irrelevant geworden ist, ist den türkischen Nationalisten um die "Grauen Wölfe" vor allem in den vergangenen Jahren der Marsch durch die Institutionen geglückt. Um sie besser zu verstehen, hätte es dem lesenswerten Sammelband gutgetan, würde er sich neben den militanten linken Ideologien mehr mit den militanten rechten Umtrieben jenes Jahrzehnts und dem Einfluss des Kalten Kriegs beschäftigen.
RAINER HERMANN
Berna Pekesen (Hrsg.): "Turkey in Turmoil". Social Change and Political Radicalization during the 1960s.
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2020. 331 S., geb., 86,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main