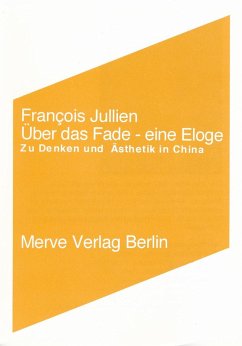"Sein Buch gehört zu den schönsten und subtilsten der letzten Zeit. Es berichtet von einer chinesischen Ästhetik des klaren geschmacklosen Wassers, von Nebel und weiten Landschaften, von angerissenen Tönen und lapidaren Gedichten, kurz von einem Willen zur Fadheit. ein Vademecum der Nachdenklichkeit." (Michael Glasmeier, Zitty)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der französische Sinologe François Jullien, ehemaliger Präsident des Collège International de Philosophie, hat in der vergangenen Zeit durchschnittlich zwei Bücher pro Jahr veröffentlicht. Sie haben das China-Bild der im 6. Arrondissement von Paris versammelten Intellektuellen ganz beträchtlich geprägt. In jedem dieser Werke wird ein nach Meinung des Autors wesentlicher Zug des "chinesischen Denkens" herausgearbeitet: etwa die Bevorzugung des "Umwegs" gegenüber dem "agonalen Prinzip" oder die angebliche Allgegenwart des "prozessualen Denkens" gegenüber dem Schöpfungsgedanken. All diese Bücher leben von einer bald mehr, bald weniger eingestandenen Dichotomisierung einer "chinesischen Kultur" gegenüber dem - zumeist in klassizistischer Manier auf das Griechentum zurückgeführten - "Westen". Wenn Jullien in diesem Tempo weiterschreibt, werden wir bald Zeugen einer Wiedergeburt der "Chinese Characteristics" in Gestalt einer Reihe von Monographien werden.
Die stark kulturalisierenden, die "chinesische Mentalität" auf einige wenige Merkmale mit Ewigkeitscharakter reduzierenden "Chinese Characteristics" des Missionars Arthur Smith hatten seit der Jahrhundertwende einen ebenso großen wie unseligen Einfluß auf abendländische Wahrnehmungen Chinas, bis schließlich selbst bedeutende chinesische Denker in (post)kolonialer Komplizenschaft bereit waren, an oktroyierte Schablonen wie "Konfuzianismus", "Feudalismus", "kulturelle Abgeschlossenheit", "konservative Fremdenfeindlichkeit" und so weiter zu glauben. Trotz erfolgreicher wissenschaftlicher Dekonstruktion haben solche irrtümlichen Gemeinplätze heute noch eine Bastion in China, während andernorts derartige Sicherheiten längst ins Wanken geraten sind. Vielleicht wird ja auch Julliens Büchern ein ähnliches Schicksal beschieden sein, und asiatische Journalisten und Kulturpäpste werden uns eines Tages von "Fadheit", "Umweg" und "prozessualem Denken" als den Wesensmerkmalen asiatischen Denkens berichten.
Läßt man die unzulässigen, weil unhistorischen und undifferenzierten Generalisierungen unbeachtet, so ermöglicht Julliens erstes in deutscher Sprache vorliegendes Buch eine ungewöhnliche Perspektive auf ein zentrales Thema der chinesischen Elitekultur: die Feier des Neutralen und Geschmacklosen als des höchsten Werts ästhetischer Empfindung ("Über das Fade - eine Eloge". Zu Denken und Ästhetik in China. Aus dem Französischen von Andreas Hiepko und Joachim Kurtz. Merve Verlag, Berlin 1999. 191 S., br., 24,- DM). Jullien legt Wert darauf, daß die Freude am Faden jenseits aller Transzendenz im Bereich des Sinnlichen verbleibt. In Schrifttum, Musik, Malerei galt zu manchen Zeiten die von Gegensätzen unberührte Mitte als etwas "Frisches", dem Wasser zu vergleichen, als "Geschmack jenseits des Geschmacks"; Fadheit ist somit intensiver als jede explizite Intensität. Der Widerwillen gegen jede Aktualisierung gipfelt etwa in der Musik auf der saitenlosen Zither, auf der Tao Yuanming im ausgehenden vierten Jahrhundert "ausdrückte, wonach sein Herz strebte". In der Malerei erreicht, späteren Kritikern zufolge, Ni Zan im vierzehnten Jahrhundert jene Loslösung von der Welt, in der die Originalität des Faden wurzelt. Einmal eingetreten in die Welt der Fadheit, gibt es keinerlei Ablenkung durch den charmanten Schein des Äußerlichen - und alles Vergängliche wird eben zum Gleichnis, auch in China. Mochte Hegel die Lehren des Konfuzius für "geschmacklos" halten - eben in ihrer Fadheit, so Jullien, besteht ihr Wesen.
Jullien will die Querverbindungen der Fadheit zu anderen zentralen Begriffen wie "Leere", "Ruhe", "Mitte" und schließlich auch der - bisweilen synonym gebrauchten - "Loslösung" aufzeigen. Für den Siegeszug des Faden im Bereich der traditionellen Literaturkritik seit dem vierten Jahrhundert entwickelt er sogar eine historische Perspektive, mit der er ansonsten auf Kriegsfuß zu stehen scheint; allzusehr werden Perioden, Genres und regionale Stile durcheinandergeworfen, allzuwenig erfährt der Leser über die Geschichte von Begriffen, Stilen und Theorien. Zumeist ist es denn doch das "ewige China", das uns entgegentritt. Daß Nordchinesen bis zum heutigen Tag die südchinesische Küche schlecht, weil fade finden, daß die chinesische Dichtung überaus reich an Liedern zum Lobe des Reichtums und der Pracht ist, daß Farbenfreude im literarischen, bildlichen und lebensweltlichen Ausdruck stets zum chinesischen Alltag gehört hat - das alles übersieht Jullien, weil er uns ein Bild der "chinesischen Kultur" liefern möchte, die im Grunde nur ein Pendant der französischen "culture" ist: So wird der Habitus einer auf Farblosigkeit eingeschworenen Bildungselite zum Ausdruck einer Nationalkultur stilisiert.
An einen Essay sollte man freilich nicht Maßstäbe strenger Wissenschaftlichkeit anlegen; Jullien umkreist sein Thema mehr, als daß er ihm wirklich nachforscht: So finden sich in seiner Blütenlese chinesischer Literatur nach und nach für die Fadheit die rechte Jahreszeit (Spätherbst), das rechte Element (Wasser), die rechte Sozialtechnik (der Ausgleich) und der rechte Ort (die spurenlose Bergeseinsamkeit). Erfunden ist dies alles nicht, nur hat der essayistische Genius ein wenig nachgeholfen. Den wichtigsten Aspekt der Fadheit in der chinesischen Kultur, der das "Lob der Fadheit" zu einem Meilenstein in der zeitgeistgemäßen Verbindung von Postmoderne und Gesundheitsbeflissenheit machen könnte, hat Jullien allerdings übersehen: Viele der von ihm zitierten Sinnsprüche ("Wenn das Tao durch unseren Mund geht, ist es fade und ohne Geschmack"; "es gibt in der Welt der Menschen den Geschmack: und es ist seine Klarheit, die wir mögen") finden sich auf chinesischen Teekannen der billigsten und teuersten Sorten. Und was gibt es Faderes als chinesischen grünen Tee?
MICHAEL LACKNER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main