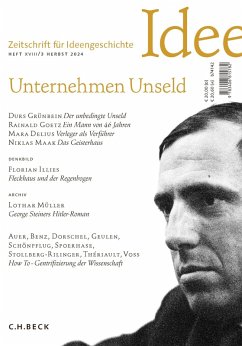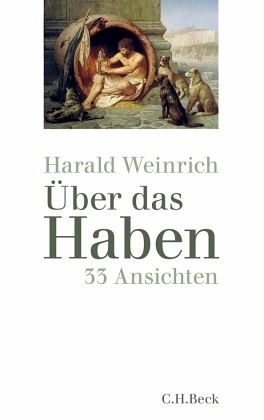
Über das Haben
33 Ansichten

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Am Eingang dieses Buches begrüßt uns Diogenes von Sinope, der nichts haben will, nicht einmal von Alexander dem Großen. Er ist freilich die Ausnahme. Die meisten Menschen haben gern, und deshalb mangelt es auch nicht an Gründen und Anlässen, sich über das Haben zu äußern. In einer höchst unterhaltsamen Reise durch die Sinnwelten des Habens eröffnet Harald Weinrich, der Grandseigneur der europäischen Sprachwissenschaft, verblüffende Einsichten in unseren Gebrauch des Wörtchens Haben - und unser Haben-Denken, das sich darin offenbart.Von den philosophischen Kategorien des Aristotele...
Am Eingang dieses Buches begrüßt uns Diogenes von Sinope, der nichts haben will, nicht einmal von Alexander dem Großen. Er ist freilich die Ausnahme. Die meisten Menschen haben gern, und deshalb mangelt es auch nicht an Gründen und Anlässen, sich über das Haben zu äußern. In einer höchst unterhaltsamen Reise durch die Sinnwelten des Habens eröffnet Harald Weinrich, der Grandseigneur der europäischen Sprachwissenschaft, verblüffende Einsichten in unseren Gebrauch des Wörtchens Haben - und unser Haben-Denken, das sich darin offenbart.
Von den philosophischen Kategorien des Aristoteles, von denen eine das Haben ist, bis zu Romeo und Julia, die nur noch sich selber haben, und Martin Luther King, der einen Traum hat, betrachtet Harald Weinrich in seinem neuen Buch den Umgang mit dem Wort Haben. Selbst der "Habenichts" Hitler kommt darin zu Wort. Weinrichs Blick gilt aber nicht nur den Philosophen und Dichtern, den Tyrannen und Freiheitshelden. Auch das leidige Haben und Nicht-Haben, das Haben, das man nun einmal nicht besitzen kann, das höflichere Haben und der (andere) Umgang mit dem Haben in anderen Sprachen und Grammatiken finden in dieser kleinen Aufklärung über das Haben ihren eleganten Portraitisten.
Von den philosophischen Kategorien des Aristoteles, von denen eine das Haben ist, bis zu Romeo und Julia, die nur noch sich selber haben, und Martin Luther King, der einen Traum hat, betrachtet Harald Weinrich in seinem neuen Buch den Umgang mit dem Wort Haben. Selbst der "Habenichts" Hitler kommt darin zu Wort. Weinrichs Blick gilt aber nicht nur den Philosophen und Dichtern, den Tyrannen und Freiheitshelden. Auch das leidige Haben und Nicht-Haben, das Haben, das man nun einmal nicht besitzen kann, das höflichere Haben und der (andere) Umgang mit dem Haben in anderen Sprachen und Grammatiken finden in dieser kleinen Aufklärung über das Haben ihren eleganten Portraitisten.