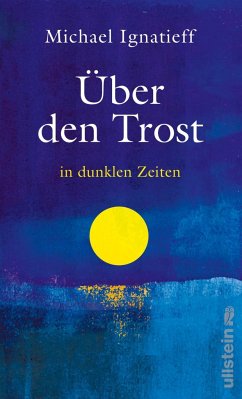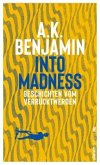Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, Verluste oder Schicksalsschläge erleiden, suchen wir nach Trost. Gesucht wird Trost heute immer weniger in religiösen Institutionen und politischen Traditionen. Stattdessen wird das Bedürfnis nach Trost zunehmend ins individuell Zwischenmenschliche und in private Netzwerke verlagert. Michael Ignatieff geht der Frage nach, wie es uns über Jahrtausende gelungen ist, Traditionen des Trosts zu erschaffen. Das Buch Hiob, die Psalmen und die Werke von Künstlern so verschieden wie Albert Camus, Anna Achmatowa und Primo Levi sind zeitlose Botschaften der Hoffnung. Diese verbindende Sprache des Trosts hat Generationen von Menschen dazu inspiriert, ihr Schicksal mit Würde zu anzunehmen. Ignatieff erweckt sie zu neuem Leben und zeigt, wie sie uns auch im 21. Jahrhundert helfen können, dem Leid und der Ungewissheit in der Welt hoffnungsvoll zu begegnen.
Dieses Buch ist anders als die üblichen Trost-Ratgeber, versichert Rezensent Nils Minkmar. Nur: Trösten will es ihn nicht. Denn der kanadische Ideenhistoriker Michael Ignatieff ist das "Schweizer Offiziersmesser" unter den gegenwärtigen Autoren, fährt der Kritiker fort. Nicht ohne Interesse folgt er Ignatieff, einst unter anderem Chef der Liberalen Partei in Kanada, Harvard-Professor und BBC-Dokumentarfilmer, durch die Kulturgeschichte des Trostes, vorbei an Cicero und Michel de Montaigne. Minkmar erhält allerhand Einblicke in Erfahrungen von Leid in den vergangenen Jahrhundert, nur leider auch das Gefühl, dass sich der Autor nicht recht für sein Sujet interessiert. Zu oberflächlich scheint ihm Ignatieffs Herangehensweise, als "Einführung ins abendländische Denken" kann er das Buch dennoch empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Michael Ignatieff hat ein Buch über das Trösten geschrieben, das ganz anders ist als die übliche Ratgeberliteratur
Man soll, so das populäre Mantra der Ermutigung, einfach wieder aufstehen, wenn es einen mal umgehauen hat: Nicht der Sturz sei eine Schande, sondern das Liegenbleiben. Alle haben das schon oft gehört, es ist der westliche Welthit der spontanen Selbstheilung, einer Ertüchtigung allein durch Willenskraft. Das passt zum modernen Lob der Resilienz, des Was-draus-machen und der immerwährenden Selbstverbesserung auch unter widrigen Umständen.
Aber was ist mit jenen Lebenslagen, in denen das nicht geht? In denen der Schock, der Schmerz und die Trauer so gewaltig sind, dass sie menschliche Kräfte übersteigen? Was ist mit einer fatalen Diagnose, bei sich oder bei nahen Angehörigen, mit Unfällen, Verbrechen oder anderen Schicksalsschlägen? Nur wer einen ganz und gar naiven Blick auf die Welt pflegt, wird leugnen, dass es Erfahrungen gibt, bei denen eine einfache Rückkehr zum Leben davor unmöglich ist. Was sagt man dann?
In so einer Lage fand sich der kanadische Ideenhistoriker Michael Ignatieff, als er einen Freund besuchte, dessen Frau kurz davor verstorben war. Er brachte ihm Kuchen mit, suchte nach guten Worten, aber der Freund wurde von einem Gedanken umgetrieben, zu dem er seine Meinung hören wollte: „Wenn ich nur sicher sein könnte, sie einmal wieder zu sehen!“ Nun war Ignatieff in der Klemme, denn wer, wie die meisten Zeitgenossen heute, nicht mehr an Himmel und Hölle glaubt, kann das nicht leichten Herzens versichern. Was sagt man dann? Wie tröstet man in so einer Situation?
Ignatieff fand den Beginn einer Antwort, als er in Utrecht einem Chorkonzert beiwohnte, bei dem Psalmen gesungen wurden. Diese alten Texte, ihre Sprache und die Musik vermittelten ihm ein Gefühl der Geborgenheit und des Trostes, er konnte weinen. Doch worin genau bestand der Trost? Nicht in einem intellektuellen Sinn, aber auch nicht in einem religiösen Versprechen, schließlich sind die Psalmen längst Teil einer universellen Trostkultur.
Ignatieff machte sich daran, die Disziplin des Trostspendens zu studieren. Sie ist in Vergessenheit geraten, denn heutige Philosophen oder Coaches möchten Glück und Erfolg preisen und ermöglichen, durch gute Ratschläge zum Gelingen des Lebens beitragen – und nicht überlegen, was man sagt oder tut, wenn einfach die Worte fehlen.
Aber genau das war natürlich viele Jahrhunderte lang eine zentrale Komponente der menschlichen Erfahrung: Allein die Kindersterblichkeit war bis ins 20. Jahrhundert hinein derartig groß, dass kaum einer Familie, kaum einem Erwachsenen der immense Schmerz des Verlusts eines Kindes erspart blieb.
Der Kanadier untersucht das alles, gibt es mit eigenen Worten wieder, und leider fangen hier die Probleme an: Michael Ignatieff ist das Schweizer Offiziersmesser unter den zeitgenössischen Autoren. Er war bis zum vergangenen Sommer Universitätspräsident der Central European University, davor Chef der Liberalen Partei und Abgeordneter in Kanada, Professor in Harvard und Dokumentarfilmer für die BBC. Er hat Romane geschrieben und Sachbücher, Artikel und vieles andere mehr. Er bietet einiges, der intellektuelle und feuilletonistische Allrounder mit einem respektablen Werk, doch etwas fehlt.
Auch das vorliegende Buch über den Trost macht vieles richtig: Die wichtigen Personen kommen vor, Ignatieff bemüht sich um Ausgewogenheit, einen humanistischen Liberalismus und hegt stets die allerbesten Absichten – aber ehrlich gesagt liest sich das Kompendium letztlich auch ein bisschen langweilig.
Bewegend sind die Erfahrungen von Leid und Heimsuchung durch die Jahrhunderte, die Schilderung der Trauer des großen Cicero beispielsweise. Selbst wenn Ignatieff jedoch, etwas treuherzig, den Männlichkeitsbegriff des antiken Roms mit heutigen Maßstäben kritisiert – es wirkt, als seien ihm diese Kultur und Empfindungen fern und verschlossen.
Auch wenn er über Michel de Montaigne referiert, verlässt er selten die Komfortzone dessen, was sich ohnehin schon alle zu diesem Autor und seinem Werk denken. Dass ihm das Thema, der Philosoph und dessen „Essais“ wichtig wären, ist leider nicht zu erkennen.
So springt für Leserinnen und Leser kaum ein Funke über. Man liest Kapitel um Kapitel wie ein Handbuch des abendländischen Trostes, es ist ein Hüpfen über die Oberfläche tief im Wasser liegender Felsen. Ohne Freude am Plätschern, sondern das Ufer immer fest im Blick. Die Botschaft besteht darin, zu erinnern, dass wir gerade dann, wenn wir vom Schicksal umgehauen wurden, in Gesellschaft sind, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
Daraus ergibt sich ein Buch, das man bedenkenlos Menschen schenken kann, die sich in der Erfahrung des Verlusts allein fühlen. Man greift zu diesem Band, wenn man keinen der üblichen Ratgeber möchte und Trauer nicht als zu therapierende Störung der geistigen Gesundheit begreift. Dann mag dieses Kompendium als eine Art Einführung ins abendländische Denken dienen, und man macht nichts falsch.
NILS MINKMAR
Heutige Philosophen und Coaches
möchten lieber Glück und Erfolg
preisen und ermöglichen
Michael Ignatieff: Über den Trost in dunklen Zeiten. Ullstein, Berlin 2021.
352 Seiten, 24 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensentin Susanne Billig macht ihrer Enttäuschung Luft darüber, dass Michael Ignatieff in seinem Trostbuch nahezu ausschließlich die Nöte und Troststrategien weißer Männer beschreibt, von Hiob über Marc Aurel und Montaigne bis Marx und Havel. Ein eigenes Kapitel kann nur eine einzige Frau für sich beanspruchen, stellt Billig betrübt fest, und nicht-weiße Menschen kommen überhaupt nicht vor. Davon abgesehen bietet ihr der Autor eine unsentimentale, kenntnisreiche und stilistisch überzeugende Geschichte der Qualen und ihrer Gegenmittel - vom Stoizismus bis zum Hedonismus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH