Hans-Ulrich Treichel erbringt in seinen Texten zu Kafka und Robert Waiser, Peter Weiss und Ernst Jünger, Arno Schmidt, Wolfgang Koeppen und Hans Magnus Enzensberger, um nur einige zu nennen, den Beweis, daß Literatur und Literaturwissenschaft kein Gegensatz sein müssen, sondern im selben Garten ihre Wurzeln schlagen. Mit großer Freude am bisher übersehenen Detail taucht er »seine« Autoren in ein neues und persönliches Licht - und verleugnet sich dabei als ironischer Erzähler nie selbst.

Hans-Ulrich Treichel über die Produktivität der Krise Von Friedmar Apel
Auch Germanisten im Amt schreiben, sofern sie nicht zur Medien- oder Kulturwissenschaft entlaufen sind, Aufsätze oder Bücher über Literatur, obwohl das niemand von ihnen verlangt. Wer wäre besser geeignet, darüber zu räsonieren als der Schriftsteller und Germanistikprofessor Hans-Ulrich Treichel? Auch er betätigt sich als "Produzent des Sekundären", obwohl seine Leser vermutlich lieber weitere literarische Werke von ihm hätten. Germanisten klagen gern über mangelnde öffentliche Anerkennung ihrer Tätigkeit, aber Treichels Enthüllung, "daß auch das literaturwissenschaftliche Schreiben, einschließlich des Biographierens, Zitierens und Plazierens von Fußnoten, oft genug Arbeit am eigenen Ich ist", werden sie angesichts der Diskussion um den gesellschaftlichen Nutzen der Geisteswissenschaften vielleicht nicht so gern hören. Eher schon, daß das Schreiben über Literatur "eine intensivere Art des Lesens" ist, die vorführt, daß die Literatur die Frage ist, "die immer neu beantwortet werden muß und beantwortet werden wird". Und auch, daß es in der Literatur "wohl um Stil, aber eben auch um unser Leben geht". Treichels Buch eignet sich als Beruhigungsmittel für besorgte Leser, Verleger und Germanisten. Daß Literatur und ihre Deutung in der Krise gesehen werden, ist gerade die Garantie für ihren Bestand.
Entsprechend zeigt sich in Treichels Essays zu Hofmannsthal, Kafka, Robert Walser, Jünger, Andersch, Koeppen, Enzensberger und Botho Strauß auf symphatisch unaufgeregte Weise, daß die "existentielle" Auseinandersetzung mit Literatur ein Bedürfnis ist, das sich in der Seinsweise der Literatur selbst legitimiert. Jeder gelungene literarische Text birgt ein "Versprechen auf mediale und materiale Selbstüberschreitung", dem in der Motivation des schreibenden Lesers idealiter eine Infragestellung des erreichten Bewußtseinsstandes entspricht. So interessieren Treichel besonders Autoren und Textkonfigurationen, die die Literatur über sich hinaustreiben. In der Literatur werden Krisen produktiv, und Kafkas oder Walsers Versuche, der Schrift zu entkommen, führen nur intensiver und manchmal zwanghaft zur Fortsetzung des Schreibprojekts. "Es ist dies ein signifikantes Moment der inneren Dialektik der literarischen Tätigkeit: unaufhörlich Literatur hervorzubringen und zugleich ihre selbstnegatorischen Impulse unaufhörlich zu bestärken." Als Revers solcher Zwangsläufigkeiten ergibt sich für den deutenden Schriftsteller so etwas wie eine Utopie der literarischen und gesellschaftlichen Gelassenheit: die "Möglichkeit einer literarischen Praxis und einer Kultur, in der man immer noch und immer weiter schreiben wird, aber ohne den brennenden Wunsch oder die panische Angst, es irgendwann nicht mehr zu tun".
Vor allem in den Beiträgen zu Jünger demonstriert Treichel die ästhetische Selbsterziehung des Interpreten in der Überwindung des "identifikatorischen" wie des abwehrenden Lesens. Der ursprünglich aus dem Hörensagen abgelehnte Jünger erscheint in dem Bändchen als bevorzugtes Medium einer Selbstüberschreitung des Deuters. Treichel findet in Jüngers Texten Aufklärung darüber, "was uns erwartet jenseits der Zumutung unserer selbst". Dabei tut sich ein Widerspruch auf: Treichel betont den provokanten Charakter der Texte und der Lebensgeschichte Jüngers, doch werden beide in der Lektüre fast zum Vorbild einer distanzierten Gelassenheit, unbeschadet der vom Interpreten als skurril vermerkten Vorliebe "für Räusche und Katastrophen, für Krieg und Gewalt".
So wird gerade an Jünger Treichels Einsicht konkret, daß das "ästhetische Abenteuer der Überschreitung" längst "kulturell domestiziert" ist. Da nimmt es nicht wunder, daß sich Treichel über Botho Strauß nicht aufregt. Der Ironiker und subtile Analytiker des bundesrepublikanischen Alltags mit seinem flachsinnigen Geschwätz ist ohne den in hohem Ton sprechenden Antimodernisten und Gegenaufklärer nicht zu haben: "Er blickt in die Röhre und sucht das Arkanum. Das schärft seine Wahrnehmung. Allerdings nicht für das große Geheimnis, um das es ihm eigentlich geht. Wohl aber für das, was offenbar, trivial und bloß alltäglich erscheint."
Derart nimmt Treichel in seinen Essays vorweg, was er für das zu Erreichende erklärt: eine Art des Schreibens und der zugehörigen Haltung, die in der Krise gelassen die Produktivität erblickt, die sich vom Zwanghaften löst und den Widerspruch als Ausdruck des Lebendigen begreift. Damit nimmt Treichel in nur manchmal aufgesetzt wirkender Weisheit selbst an der Domestizierung der ästhetischen Überschreitung teil, die er diagnostiziert. Man liest das alles gern, aber aufregend ist es nicht. Im Bedarfsfall sollte sich der Leser mit Treichels Einsicht motivieren, "daß die Langeweile ein Effekt ist, der in der Literatur der Moderne sehr wohl seinen Platz hat".
Hans-Ulrich Treichel: "Über die Schrift hinaus. Essays zur Literatur". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 241 S., br., 19,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
""Sympathisch unaufgeregt" findet Friedmar Apel dieses Buch, aber sein Lob klingt reichlich sibyllinisch. Ein paar Sätze über den Schriftsteller und Germanistikprofessor Hans-Ulrich Treichel und die Sorgen der Germanisten um ihre gesellschaftliche Relevanz. Hier eigne sich das Buch "als Beruhigungsmittel", findet Apel. Wir erfahren ein paar Stichworte über Treichels Themen, lesen Namen von Autoren, mit denen seine Essays sich beschäftigen. Besonders interessiere Treichel das längst domestizierte "ästhetischen Abenteuer der Überschreitung". Doch mit seinen Überlegungen trage Treichel selbst zu dieser Domestizierung bei. Apel hat das Buch gerne gelesen, sagt er, aber aufregend fand er es nicht. Manchmal sieht man ihn hinter der vorgehaltenen Hand sogar herzzerreißend gähnen.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"

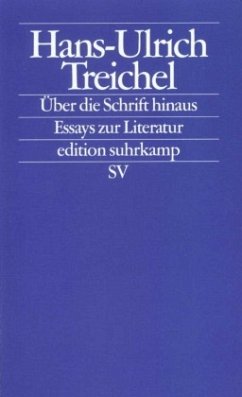







heikesteinweg_sv.jpg)