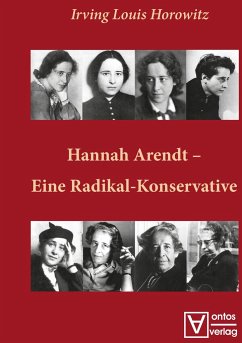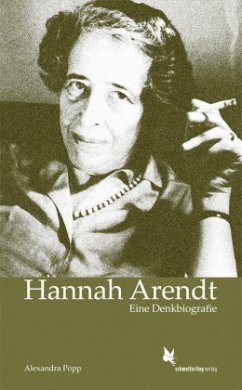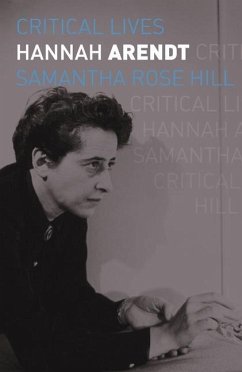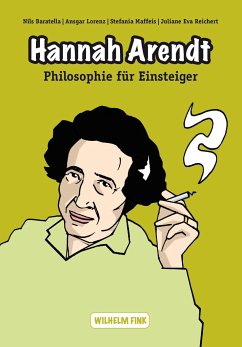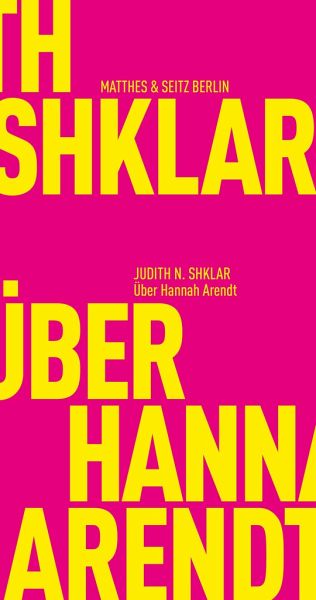
Über Hannah Arendt
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
14,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Judith N. Shklar beschäftigte sich ihr Leben lang mit Hannah Arendt. In ihren Texten zeichnet sie ein ambivalentes Bild der 22 Jahre älteren Philosophin, kommt in ihrem Werk sowohl anerkennend als auch voller Witz und polemischer Schärfe immer wieder auf sie zurück. Shklar schätzt Arendt vor allem für ihre Gedanken zu Exil und Staatenlosigkeit und für ein Ethos, das das Versprechen der Politik und des jederzeit möglichen absoluten Neuanfangs hochhält. Zugleich aber kritisiert Shklar sie als hochtrabende Metaphysikerin und enttäuschte Marxistin mit einem Hang zu politischer Romantik. ...
Judith N. Shklar beschäftigte sich ihr Leben lang mit Hannah Arendt. In ihren Texten zeichnet sie ein ambivalentes Bild der 22 Jahre älteren Philosophin, kommt in ihrem Werk sowohl anerkennend als auch voller Witz und polemischer Schärfe immer wieder auf sie zurück. Shklar schätzt Arendt vor allem für ihre Gedanken zu Exil und Staatenlosigkeit und für ein Ethos, das das Versprechen der Politik und des jederzeit möglichen absoluten Neuanfangs hochhält. Zugleich aber kritisiert Shklar sie als hochtrabende Metaphysikerin und enttäuschte Marxistin mit einem Hang zu politischer Romantik. »Über die Revolution« ist für Shklar ein »blamables Buch«, während »Arendt in Eichmann in Jerusalem« mit dem Hochmut des selbsterklärten Parias lediglich »epigonal und amateurhaft« über Politik zu reflektieren weiß. Gegen Arendts heldenhaftes Verständnis von Politik und ihre Blindheit für historische Ungerechtigkeiten stellt Shklar das Lob eines unpersönlichen Prozeduralismus und ihren eigenen Liberalismus der Furcht und der Rechte - so ist Shklars Werk nicht zuletzt gegen Arendts Denken entstanden. Mit den hier versammelten Texten ist es nun möglich, das Verhältnis zweier zentraler politischer Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen.