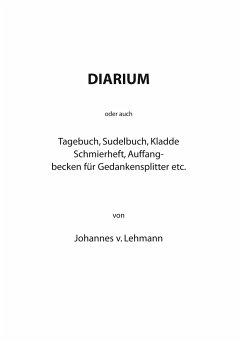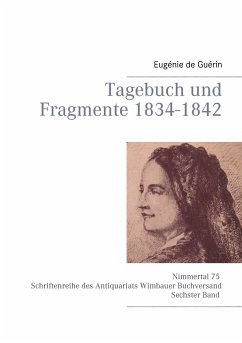Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Burkhard Müller lässt kein gutes Haar an den Notaten des DDR-Dissidenten, Theologen und früheren Weggefährten Joachim Gaucks, Ulrich Schacht. Müller missfallen die unvermittelte Abwechselung von Privatem, Poetischem und Politischem, die immer wieder durch die Ironie durchscheinende Bitternis des Autors, seinen ethischen, jegliches politische und historische Denken negierenden Rigorismus sowie seine den Kapitalismus als Teufelswerk verdammenden Wut. Dass im Buch mitunter gar eine Sympathie für totalitäre Gewalt spürbar wird, erscheint Müller geradezu absurd, schließlich habe Schacht gerade letzterer grundsätzliche Feindschaft geschworen. Im Ganzen jedoch scheint Müller beruhigt. Solange der Rechtskonservatismus inkohärent wie in diesem Buch auftritt, meint er, muss uns nicht bange sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH