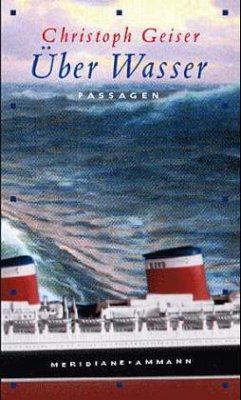Produktdetails
- Meridiane Bd.59
- Verlag: Ammann / S. Fischer Verlag GmbH
- Seitenzahl: 313
- Deutsch
- Abmessung: 30mm x 130mm x 205mm
- Gewicht: 438g
- ISBN-13: 9783250600596
- ISBN-10: 3250600598
- Artikelnr.: 11764272
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Stipendiaten soll man nicht aufhalten: Christoph Geisers Wogen
Ein Mann fährt mit dem Schiff übers Meer. Er ist der einzige Passagier eines Frachters. Den Kapitän nennt er Rossmann, damit kein Zweifel besteht, auf wen er sich bezieht. Kafkas Amerika-Roman hat er im Gepäck, und so kann er immerhin feststellen, daß die Freiheitsgöttin ihm nicht "wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht erscheint". New York ist bei seiner Ankunft neblig trüb und regnerisch. Es wirkt wenig einladend für einen, der sich an sein Schiff und sein Schreibzimmerchen darauf so sehr gewöhnt hat, daß er es gar nicht mehr verlassen will. Den regelmäßigen Rhythmus der Tage, die klosterhafte Pünktlichkeit, mit der man das Essen bekommt und ins Bett geht, gibt es nur in der Abgeschiedenheit. Aber der Mann tritt ein sechsmonatiges Stipendium an, und also muß er zu seinem Leid hinaus in die Stadt, hinein nach Amerika. Die Schriftstellerpflicht ruft.
Das ist fast schon alles, was in Christoph Geisers als "Passagen" bezeichneter Textsammlung "Über Wasser" geschieht. Nach Ablauf der sechs Monate besteigt der Erzähler wieder ein Schiff und reist nach Dresden, wo er das Amt des Stadtschreibers übernimmt. So leben Autoren in modernen Zeiten. Aus Aufenthalten und Überfahrten destillieren sie ihr Passagen-Werk, denn wer keine Texte produziert, bekommt auch keine Stipendien mehr. "Über Wasser" entstand in den Jahren 1999 und 2000. Es handelt sich also um einen Blick auf New York, der noch nicht vom Bewußtsein des 11. September bestimmt wird. Insofern läßt sich der Umstand, wie wenig Geiser mit New York anfangen kann, als historisches Dokument lesen. Wie eine nachträgliche Konstruktion wirkt jedoch die Gegenüberstellung von kaputter neuer Welt und müde gewordenem altem Europa. Die einzelnen Passagen sind als getrennte Schreibversuche entstanden und vom Autor erst für die Buchveröffentlichung in einen Zusammenhang und die "zwangsläufige Reihenfolge" gebracht worden.
A Swiss man in New York: Was der damals fünfzigjährige Schweizer dort zutage fördert - Kellner, so unfreundlich wie einst ihre Kollegen in der DDR, einstürzende Zimmerdecken und Toiletten, die sich direkt in den Abgrund zu ergießen scheinen, dampfende Heizkörper aus dem 19. Jahrhundert und überall, sehr zum Ärger des Rauchers, "smokefree facilities" -, das hat man auch schon anderswo gelesen. Es geht ihm auch gar nicht darum, Wirklichkeit zu erkunden. Was er "Wahrnehmung" nennt, ist ihm immer nur Anlaß, um sein Sprachmaschinchen in Bewegung zu halten. Jedes Wort wird so lange gedreht und gewendet, bis es zu klingeln beginnt. Ungebremste Assoziationen und Kalauer treiben die Prosa voran. So entsteht ein endloser, monologischer Wortstrom, der keinen anderen Gegenstand hat als das eigene Bemühen um Originalität.
Die Syntax ist aufgebrochen und reichlich mit Satzzeichen aller Art gewürzt. Jedes "oh" und "äh", "quasi" und "und/oder" pflanzt sich fest, so daß man als Leser schier verzweifeln möchte. Die Mischung aus Beschaulichkeit und Hochdruck, aus Schlichtheit der Beobachtung und formalem Wahn wirkt so, als habe sich Arno Schmidt über mißlungene Versuche von Robert Walser hergemacht. Das Ergebnis ist eine permanente Munterkeitsbemühung, die ein paar Seiten lang erfreut und dann nur noch ermüdet. Da schottet sich einer mit Hilfe der Sprache von der Welt ab. Hermetische Reiseliteratur: Was der Erzähler außer einer Lesung in der Provinz und fortgesetzten Gängen durch die Wörter-Welt erlebt, ist: nichts.
Am stärksten sind die Kapitel, die auf dem Meer spielen. Vielleicht deshalb, weil die Weite, die Leere, die Verschwendung von Zeit und Worten das eigentliche Thema Geisers sind. Das Wortgeplätscher und Satzgewoge finden hier gewissermaßen zu sich selbst und entsprechen dem Gegenstand. Meeresblubbern, quasi. Oder, um Geiser zu zitieren: "Ein Zeitvertreib, weil eben nichts zu sehen war, nichts! rien, nothing." Bei den Bildern, die auf der Wasseroberfläche entstehen, handele es sich um "eine quasi optische Täuschung, ich meine: um eine quasi fantasievolle Interpretation optischer Brechung, eine optische Fiktion" etc. pp. Wenigstens verkneift sich Geiser an dieser Stelle den Scherz, Fiktion als Fick-tion zu schreiben, was er ansonsten recht gerne tut.
In Dresden besucht der Stadtschreiber-Erzähler dann immer wieder das Albertinum und erfreut sich an den romantischen Landschaften Caspar David Friedrichs. Die Sprache aber pulst und köchelt weiter. Das witzelt und frotzelt und kalauert, bis man selbst auf diesen Bildern nichts mehr sieht: eine Wahrnehmungsvernichtung. Erst im letzten Kapitel naht Erlösung - "Beinahe hat er es geschafft!" -, und endlich wird Vollzug gemeldet: "Die Außenwelt ist weg." Man brauche nichts zu sehen, wenn man genug empfindet, meint Geiser. Wo nichts Spannendes geschieht, will er die Spannung selbst erzeugen. Schön wär's. Spannung ist nun wirklich das allerletzte, was "Über Wasser" zu bieten hat.
JÖRG MAGENAU
Christoph Geiser: "Über Wasser". Passagen. Ammann Verlag, Zürich 2003. 314 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Georges-Arthur Goldschmidt hat ganz schön was erlebt mit Christoph Geisers Buch: Er hat die Worte entkleidet gesehen, als bewegliche Körper, als Weltwunder - "Spracherlebnisse" eben, die das Wort über seinen Sinn hinaus ins wilde Spiel bringen. Doch von vorne: Der Erzähler begibt sich auf eine Reise nach Amerika und dann zurück nach Dresden - aber eigentliche auf eine "parodistische Selbsttour" - und taucht dabei ein in die Nebensächlichkeiten, die sonst beim Erzählen am Wegesrand liegen bleiben: "Das Auge spricht und sieht die Welt so sonderbar auf vielfältige, unerschöpfliche Weise verfehlt, und dabei steht immer ein fast aberwitziges Wortgeräusch zur Verfügung". Und das alles, beteuert Goldschmidt, ist so unfassbar witzig, dass es "einem vor Lachen kalt den Rücken hinunterläuft".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH