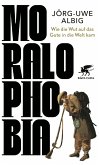Ein augenöffnender philosophischer Beitrag zur Debatte um Umwelt und Kapitalismus: Der französische Philosoph Pierre Charbonnier gilt als »der neue philosophische Kopf einer politischen Ökologie« (so die französische Zeitschrift Libération). In »Überfluss und Freiheit« entwirft er die erste philosophische Ideengeschichte zum Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die ökologische Krise der Gegenwart sieht er als Chance, sozial und politisch umzudenken und als Gesellschaft neue Wege zu gehen. Dabei setzt Charbonnier auf eine radikal andere Politik, die nicht notwendig mit Verzicht verbunden ist.
Bei jedem Klimagipfel werden Ziele formuliert - doch die vereinbarten politischen Regelungen genügen nicht, um diese zu erreichen. Warum ist das so? In einem Gang durch 300 Jahre Ideengeschichte von John Locke und Adam Smith über Saint-Simon, Karl Marx und Herbert Marcuse bis zum Club of Rome und den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion und Greta Thunberg zeigt Pierre Charbonnier: Die Erde wird seit dem 17. Jahrhundert als unerschöpfliche Quelle von Wohlstand und Wachstum gesehen. Alle seither entwickelten politischen Ideen beruhen darauf, vor allem die zentralen Begriffe von Freiheit und Gleichheit, von Autonomie und von Wachstum bzw. Überfluss. Doch das ist eine fatale Sicht auf das Verhältnis von Mensch und Natur. Wir brauchen eine philosophische Neudefinition dieser Beziehung, wenn wir nachhaltige politische, soziale und wirtschaftliche Ideen und Konzepte wollen. Pierre Charbonnier liefert die Grundlage dafür - klug und anregend, optimistisch und radikal!
Bei jedem Klimagipfel werden Ziele formuliert - doch die vereinbarten politischen Regelungen genügen nicht, um diese zu erreichen. Warum ist das so? In einem Gang durch 300 Jahre Ideengeschichte von John Locke und Adam Smith über Saint-Simon, Karl Marx und Herbert Marcuse bis zum Club of Rome und den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion und Greta Thunberg zeigt Pierre Charbonnier: Die Erde wird seit dem 17. Jahrhundert als unerschöpfliche Quelle von Wohlstand und Wachstum gesehen. Alle seither entwickelten politischen Ideen beruhen darauf, vor allem die zentralen Begriffe von Freiheit und Gleichheit, von Autonomie und von Wachstum bzw. Überfluss. Doch das ist eine fatale Sicht auf das Verhältnis von Mensch und Natur. Wir brauchen eine philosophische Neudefinition dieser Beziehung, wenn wir nachhaltige politische, soziale und wirtschaftliche Ideen und Konzepte wollen. Pierre Charbonnier liefert die Grundlage dafür - klug und anregend, optimistisch und radikal!

Pierre Charbonnier setzt denkbar grundsätzlich an, um eine letzte Abzweigung vom westlichen Weg in die ökologische Katastrophe zu finden
In der Politik hat es sich bewährt, ein großes Vorhaben, bei dem man weiß, dass jeder Schritt Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche hat, in möglichst viele kleine Schritte zu untergliedern, um nicht so-gleich am geballten Widerstand aus allen Bereichen der Gesellschaft zu scheitern. Das hat zur Folge, dass Zielrichtung und Dauer des Projekts zumeist nur schemenhaft zu erkennen sind, und zwar nicht nur für jene, die davon betroffen sind, sondern auch für die, die als politische Steuerleute auftreten und in eine ungefähre Richtung lossegeln wollen, um zu sehen, wie weit sie kommen. Wüssten sie, wie lange die Reise dauern und mit welchen Risiken sie verbunden sein wird, würden sie wahrscheinlich nicht losfahren - und wenn Mannschaft und Passagiere davon erführen, würden sie meutern oder das Schiff verlassen.
Solches Losfahren ohne Zielangabe und genaue Kursbestimmung, wie es die Politiker pflegen, hat den politischen Intellektuellen seit jeher missfallen, weswegen vor allem die Philosophen unter ihnen über die Voraussetzungen der Fahrt und deren Zielangaben nachgedacht und dabei noch vor Beginn der Reise eine Kartographie ihres prospektiven Verlaufs in Umlauf gebracht haben. Aber weil auch sie bei aller Gedankenschärfe die Ungewissheit des Zukünftigen nicht aufzulösen vermögen, untersuchen sie frühere, ähnliche Vorhaben, und darunter insbesondere solche, die in eine ganz andere Richtung gingen, um so eine Vorstellung von den Herausforderungen des angesagten Projekts zu bekommen.
Auf diese Weise ist auch der französische Philosoph Pierre Charbonnier an das Projekt eines ökologischen Umbaus der Industriegesellschaften und der Weltwirtschaft herangegangen: Er hat sich auf einen Streifzug durch die Ideengeschichte der europäischen Neuzeit begeben und sich dabei keineswegs, wie der Untertitel seines Buches nahelegt, auf die genuin politischen Ideen beschränkt, sondern auch soziologische und ökonomische Theorien einbezogen und sich obendrein mit der philosophischen Anthropologie, Arbeiten zur Struktur nichtlinearen Denkens und post-colonial studies auseinandergesetzt. Außerdem hat er historische Arbeiten zum Stand der Produktivkraftentfaltung und zur jeweiligen Technologie und Wissenschaft herangezogen, um den materiellen Resonanzraum der Theorien auszuleuchten. Ein wahrlich groß angelegtes Projekt, aus dem ein ideengeschichtlich bemerkenswertes Buch hervorgegangen ist, das die Frage unseres Verhältnisses zur Natur auch noch mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern und dem Ende des Ausbeutungsverhältnisses zwischen globalem Norden und globalem Süden verbindet.
Charbonniers Buch ist in mancher Hinsicht ein Gegenentwurf zu den um die Jahrtausendwende vermehrt vorgelegten Studien, in denen es um die Ursachen der (zeitweiligen) europäischen Weltherrschaft und die Gründe für den Reichtum im Westen und die Armut im Rest der Welt ging. Charbonnier zeigt, wie eine spezifische Art des Denkens, die er mit Europa und den Vereinigten Staaten verbindet, zu einer Verkettung von Autonomie und Überfluss beziehungsweise, präziser, zur Begründung von politischer wie persönlicher Autonomie auf sozioökonomischem Überfluss, zur Dichotomie von Natur und Gesellschaft und zu tief liegenden epistemischen Voraussetzungen der ökologischen Krise geführt haben. Ändern sich die Grundkategorien unseres Denkens nicht, werden wir den Weg in Richtung ökologische Katastrophe nicht verlassen.
Charbonnier polemisiert zwar gegen Millenaristen und Apokalyptiker, ist aber zugleich auf deren Botschaften angewiesen, um das Erfordernis der von ihm eingeforderten "Totalkehre" plausibel zu machen. Und zugleich mokiert er sich über die politischen Konzepte einer Kreislauf-wirtschaft oder des Ökomodernismus, weil sie bloß an den Symptomen der Naturüber-forderung herumdoktern würden, während es doch darum gehe, den Entwicklungspfad des westlichen Denkens zu verlassen. Charbonnier argumentiert also in genau entgegengesetzter Richtung zur politikpragmatischen Kleinteilung der Probleme und setzt auf eine Generalrevision unseres Selbstbildnisses und der Art unseres Denkens. Damit positioniert er sich jenseits aller ökologischen Politik als Autor, der alle bisherigen politischen wie intellektuellen Bemühungen zur Rettung des Lebens auf der Erde mit äußerster Skepsis beurteilt.
Die mangelnde politische Anschlussfähigkeit von Charbonniers Überlegungen ist das eine. Auf sie mag ein Intellektueller bewusst verzichten, wenn es ihm um Grundsätzliches geht. Etwas anderes ist dagegen die Frage nach der Stimmigkeit der intellektuellen Herleitung dieses epistemischen Prinzipialismus, die Charbonnier bei seinem Gang durch die Ideen- und Theoriegeschichte von Hugo Grotius und John Locke bis Claude Levi-Strauss und Bruno Latour für sich in Anspruch nimmt.
Charbonniers Schlüsselbegriff dabei lautet "Affordanz", ein der Psychologie entstammender Begriff, der zuletzt, nachdem er von James Gibson auf die Wahrnehmung der Umwelt übertragen worden ist, in den Kulturwissenschaften größere Verbreitung gefunden hat und so viel wie den Aufforderungscharakter eines Natürlichen bedeutet. Die noch unbearbeitete Natur selbst fordert danach den sich in ihr Bewegenden auf, einen bestimmten Gebrauch von ihr zu machen. Die "Affordanz" des Bodens etwa liegt für Charbonnier darin, dem Menschen seine Aneignung nahezulegen. Was Charbonnier dabei nicht erklären kann, aber erklären müsste, um sein Konzept plausibel zu machen, ist der Umstand, dass die Jäger-und-Sammler-Gesellschaften über Jahrtausende diese Affordanz nicht wahrgenommen haben, sondern die Natur erst, so Charbonniers Darstellung, mit dem Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht die "Affordanz" des Teilens und Aneignens an den Tag gelegt hat.
Charbonnier entwickelt den Gedanken der Affordanz im Kontext der Theorien von Hugo Grotius, der das teilbare und insofern eigentumsfähige Land von dem unteilbaren und darum allen gehörenden offenen Meer unterschied, und John Locke, der Eigentum auf der Bearbeitung des Bodens und nicht auf dessen erster Inbesitznahme begründete. Ideengeschichtlich treffen wir bei Grotius und Locke auf die für die bürgerliche Gesellschaft grundlegenden Überlegungen zu Eigentum und Teilbarkeit auf der einen und zum Gemeineigentum der Menschheit auf der anderen Seite - was Charbonnier gegeneinanderstellt, um seine Grundidee, wonach die Verbindung von Sozialismus und Ökologie die letzte Chance der Menschheit sei, plausibel zu machen. Denn erst Teilung und Aneignung hätten den Prozess der Naturzerstörung in Gang gesetzt.
Wäre das richtig, müssten wir uns über die Verschmutzung der Meere, ihre Überfischung und vieles mehr keine Gedanken machen. Dass gerade das Gemeineigentum eine besonders nachlässige bis zerstörerische Behandlung erfährt, hätte Charbonnier bei der Beschäftigung mit den ökologischen Herausforderungen eigentlich auffallen müssen. Sein Problem ist, dass er die spezifischen Rechtskonstruktionen von Gesellschaftsformationen in einen Aufforderungscharakter der Natur verwandelt hat, dessen Spezifität und Historizität er nicht erklären kann.
Tatsächlich geht es ihm in den einschlägigen Passagen jedoch um die bald zehntausend Jahre zuvor stattgefundene neolithische Revolution, also den Übergang von Jäger-und-Sammler-Verbänden zu sesshaft betriebenem Ackerbau und zur Viehzucht, mit denen sich frühe Eigentumsvorstellungen verbanden. Deren Fortentwicklung verfolgt Charbonnier bis hin zur industriellen Produktion und den mit ihr verbundenen Theorien, um dabei ein ums andere Mal auf die jeweiligen Affordanzen der Natur zu sprechen zu kommen.
Letztlich dreht sich dabei alles um die Frage, ob Gesellschaften dieser Affordanz erliegen oder ihr die kalte Schulter zeigen und der Natur damit Eigenrecht und Eigenentwicklung lassen. Affordanz ist bei Charbonnier ein sich wissenschaftlich gebendes Konstrukt für die biblische Erzählung von der Versuchung der Eva im Paradies. Eva erlag ihr, womit die Unterwerfung der sich dafür anbietenden unbearbeiteten Natur begann - in diesem Fall durch den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Es ist ein Holzweg, auf den Charbonnier die Ökologiebewegung locken will, nicht nur politikpragmatisch, sondern auch intellektuell. HERFRIED MÜNKLER
Pierre Charbonnier:
"Überfluss und Freiheit". Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen.
A. d. Französischen von A. Hemminger. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2022. 506 S., geb., 36,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Annette Jensen scheint enttäuscht von Pierre Charbonniers Versuch, die Geschichte umzuschreiben. Wie der Philosoph zunächst 400 Jahre Ideologiegeschichte von Locke bis Marcuse nachzeichnet, liest Jensen mit Interesse, auch wenn der Autor sie eher pflichtschuldig arbeitet, wie sie findet. Wenn Charbonnier nach neuen Sichtweisen auf Begriffe wie Demokratie oder Freiheit schielt, wird es laut Jensen allerdings dünn. Spätestens hier wird für die Rezensentin spürbar, dass Charbonnier rein ideengeschichtlich vorgeht und reale Erfahrungen scheut.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
ein ideengeschichtlich bemerkenswertes Buch Herfried Münkler Frankfurter Allgemeine Zeitung 20220713
Rezensent Herfried Münkler lobt zuerst Pierre Charbonniers Arbeit als Ideengeschichte der europäischen Neuzeit, die auch die Auseinandersetzung mit soziologischen, ökonomischen und philosophischen Theorien nicht scheut und unser Verhältnis zur Natur neu zu bestimmen sucht. Die besondere Denkweise, die der Autor dabei dem Westen unterstellt, die laut Charbonnier zur Spaltung von Natur und Gesellschaft und in die ökologische Krise geführt hat und die der Autor schleunigst zu verlassen rät, bereitet Münkler allerdings Kopfzerbrechen. Nicht nur hält er sie für politisch wenig anschlussfähig, auch scheint ihm ihre Herleitung bei Charbonnier nicht stimmig. In seiner Besprechung führt Münkler das weiter aus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH