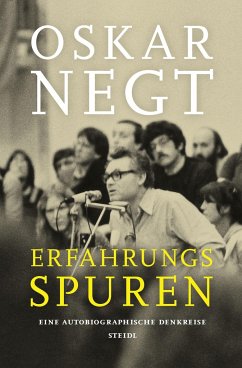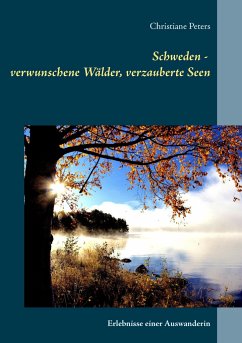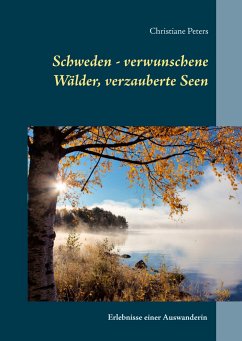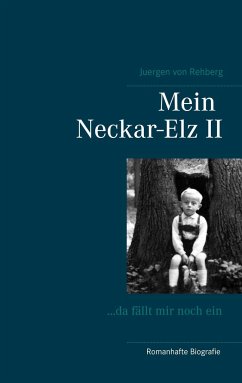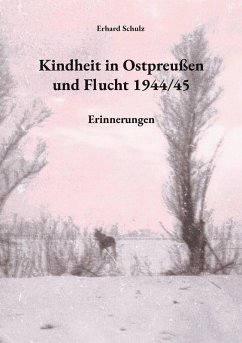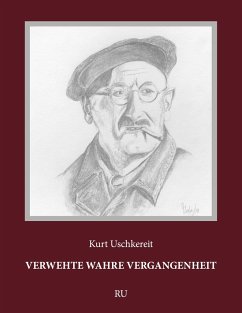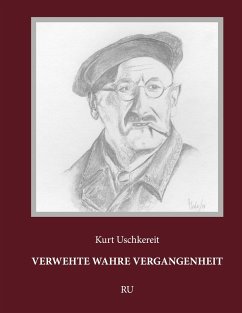Überlebensglück
Eine autobiographische Spurensuche

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Oskar Negt hat Glück gehabt. Sein Leben könnte als Erfolgsgeschichte erzählt werden: Als jüngstes von sieben Kindern auf einem Kleinbauernhof ohne Bildungsgüter im ostpreußischen Kapkeim aufgewachsen, wurde er zum Repräsentanten der Frankfurter Schule, zum anerkannten, in der ganzen Welt geehrten Philosophen und Soziologieprofessor. Doch Negts Kindheit und Jugend war von schmerzhaften Erfahrungen und Erlebnissen geprägt, von der Flucht mit zwei halbwüchsigen Schwestern in die "Totenstadt" Königsberg und über die Ostsee nach Dänemark, wo er jahrelang in Internierungslagern lebte bis...
Oskar Negt hat Glück gehabt. Sein Leben könnte als Erfolgsgeschichte erzählt werden: Als jüngstes von sieben Kindern auf einem Kleinbauernhof ohne Bildungsgüter im ostpreußischen Kapkeim aufgewachsen, wurde er zum Repräsentanten der Frankfurter Schule, zum anerkannten, in der ganzen Welt geehrten Philosophen und Soziologieprofessor. Doch Negts Kindheit und Jugend war von schmerzhaften Erfahrungen und Erlebnissen geprägt, von der Flucht mit zwei halbwüchsigen Schwestern in die "Totenstadt" Königsberg und über die Ostsee nach Dänemark, wo er jahrelang in Internierungslagern lebte bis die Familie nahe Ostberlin wieder zusammengeführt wurde. Und dann erneut flüchtete, diesmal Richtung Westen. Erst 1955, zehn Jahre nach dem Aufbruch aus Ostpreußen, fühlt er sich angekommen.
Negt nimmt seine individuelle Geschichte zum Anlass, grundsätzliche Fragen zu stellen: über das autobiographische Schreiben, über gesellschaftliche Orientierung und persönliche Identität. Er will ergründen, was nötig ist, damit ungünstige Ausgangsbedingungen und traumatische Erfahrungen keinen lebenslangen Opferstatus fixieren. Seine autobiographische Spurensuche weist weit über das eigene Schicksal hinaus.
Negt nimmt seine individuelle Geschichte zum Anlass, grundsätzliche Fragen zu stellen: über das autobiographische Schreiben, über gesellschaftliche Orientierung und persönliche Identität. Er will ergründen, was nötig ist, damit ungünstige Ausgangsbedingungen und traumatische Erfahrungen keinen lebenslangen Opferstatus fixieren. Seine autobiographische Spurensuche weist weit über das eigene Schicksal hinaus.