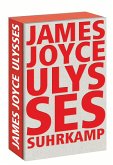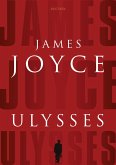Schon 1984 schuf Mimmo Paladino vier großformatige Linolschnitte zu »Ulysses« von James Joyce. Zehn Jahre später hatte der 1948 in Paduli/Italien geborene Künstler erneut die Möglichkeit, sich diesem »Welt-Alltag einer Epoche« (Hermann Broch) zu widmen: Es entstanden 18 Radierungen, deren aufwendiger Blattgoldfond an frühe Miniaturen in Stundenbüchern erinnert und die sich respektvoll vor dem Werk des Schriftstellers verbeugen. Dennoch illustrieren die Radierungen nicht bloß, sie erzählen auch ihre eigene Odysseus-Geschichte. Ihnen beigegeben sind ausgewählte Passagen aus dem »Ulysses«. Mimmo Paladino zählt zu den wichtigsten lebenden Künstlern Italiens; seine Werke wurden in zahlreichen Museen und Kunsthallen auf der ganzen Welt und auf den Biennalen in Paris, Sydney und Venedig sowie auf der Documenta in Kassel ausgestellt. Paladino lebt in Mailand und Paduli.

Und für alle jene, die ein gutes Hörbuch dem Radio vorziehen, vor allem wenn die Tonkunst in einer opulenten, bis ins kleinste Detail bestechenden Ausstattung auf CD gebrannt angeboten wird, hat der Hörverlag den Ulysses in einer Schmuckbox aufgelegt, die das Prädikat "grandios" ohne Einschränkung verdient. Dieses Hörbuch begeistert, bevor man es überhaupt gehört hat und nur in Händen hält. Dass die künstlerische Umsetzung auch mehr als gelungen ist, liegt vor allem an Dietmar Bär, der Leopold Bloom ein akustisches Aussehen verleiht. Auch hat Regisseur Klaus Buhlert, der auf "anspruchsvolle Vorlagen" abonniert ist, es in diesem Fall überzeugend verstanden, durch das Zusammenspiel von Sprechern und Musik den komplexen "Bewusstseinsstrom" von Joyce Protagonisten für den Hörer zu kanalisieren und übersichtlich zu fassen. Das Aufteilen des Bewusstseinsstroms auf unterschiedliche Sprecher, das Unterstreichen der Gedanken mit Musik erleichtert dem Hörer die Orientierung in diesem unübersichtlichen, abschreckend wirkenden wortgewaltigen Konstrukt von Stilen, Symbolen und Anspielungen. Für alle, die endlich den Ulysses lesen wollen, ohne ihn lesen zu müssen - eine Lektüre für die Ohren.
© BÜCHERmagazin, Jörn Radtke (jr)

Zum heutigen hundertsten Jahrestag des Erscheinens von "Ulysses" scheint die Begeisterung in Irland für den Roman gewaltig. Doch alles begann ganz anders.
Von Derek Scally
An einem Nachmittag im vergangenen September stehe ich mit Colm Tóibín auf dem Zürcher Friedhof Fluntern. Der Herbst kündigt sich an, die rotgoldenen Blätter der japanischen Ahornbäume rascheln leise, ebenso wie die dünnen Blätter der russischen Ausgabe von "Ulysses", die wir dort am Grab von James Joyce entdecken. Tóibín, Irlands größter literarischer Export der Gegenwart, steht in ehrfürchtigem Schweigen vor der letzten Ruhestätte des unangefochtenen Literaturgenies seines Heimatlandes.
Damals begleitete ich Colm Tóibín auf der Tournee zu seinem biographischen Roman über Thomas Mann, "Der Zauberer", nach Zürich. Beide, Thomas Mann und James Joyce, sind hier bestattet. Kaum dort angekommen, wollte Tóibín unbedingt Joyces Grab besuchen. Dort frage ich ihn, ob Thomas Mann - dessen Grab wir als Nächstes besuchen wollten - "Ulysses" jemals gelesen hat. "Mann hat 'Ulysses' durchaus gelesen", lacht Colm, "just not personally."
Auch jetzt, hundert Jahre nach seinem Erscheinen, gilt "Ulysses" als eines der am meisten besprochenen und am wenigsten gelesenen Bücher. Wir Iren lieben Aufsätze und Streit darüber, wir freuen uns, wenn Joyce-Jünger Irland besuchen. Jedes Jahr am 16. Juni - jenem Datum des Jahres 1904, das im Buch verewigt ist - feiert Dublin "Bloomsday" mit Lesungen, Gorgonzola-Sandwiches und reichlich Burgunder. Auf "Ulysses" trinken kann jeder, sich aber dem Buch widmen? Das trauen sich bei uns immer noch nur die ganz Mutigen.
Macht nichts: James Joyce und seine Hauptfigur Leopold Bloom bilden - neben Oscar Wilde mit dessen Dorian Gray und Samuel Beckett mit Godot - sowohl das Rückgrat des selbstbewussten irischen Literaturbetriebs als auch den Kern der Kulturdiplomatie des Landes. Seltsam nur, wie meine Landsleute lernten, "Ulysses" zu lieben.
Das an der Odyssee von Homer angelehnte Buch wurde bei seinem Erscheinen in Irland als "Odyssee des Schmutzes" verteufelt: kosmopolitisch, derb, zu ehrlich, zu nah am irischen Alltag für Joyces ermüdete, verunsicherte Landsleute. Zudem wurde die Veröffentlichung von einem einschneidenden politischen Ereignis überschattet. Zwei Wochen, bevor die Pariser Verlegerin Sylvia Beach "Ulysses" herausbrachte, waren die Briten am 16. Januar 1922 nach siebenhundert Jahren Besatzung aus Dublin abgezogen. Nach langen Kämpfen und schließlich einem brutalen Unabhängigkeitskrieg begann damit die Zeit Irlands als selbstverwalteter Freistaat unter der britischen Krone. Die Schlüsselübergabe am Dublin Castle sollte nur eine kurze Verschnaufpause vor einem noch blutigeren Bürgerkrieg zwischen Befürwortern und Gegnern dieses Freistaatsvertrags bleiben. Die irische Bevölkerung hatte keine Zeit für ein komplexes Werk wie "Ulysses". Wenn überhaupt, kannten die meisten Iren das Buch damals nur aus den Schlagzeilen, nachdem Auszüge in den Vereinigten Staaten als "obszön" verboten wurden.
Mit seinem Werk schuf Joyce radikal neue Möglichkeiten: sowohl für den Roman im zwanzigsten Jahrhundert als auch für die irische Identität und sogar für Hiberno-Englisch als eine kreative Weiterentwicklung des King's English. Die Debatte um "Ulysses" in Irland drehte sich zunächst aber weniger um dessen literarischen Wert als um dessen inkriminierte sexuelle Freizügigkeit und antiklerikale Frechheit. Statt Neugier gab es Empörung und die nervöse Frage: "Was werden die englischen Nachbarn über uns denken?"
Auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird, ist "Ulysses" in Irland - anders als in Großbritannien - nie offiziell verboten worden. Das Buch wurde aber so wenig beachtet, und die Lieferschwierigkeiten waren so groß, dass es kaum zu finden war. Erst nach mehr als einem Jahr veröffentlichte die "Irish Times" eine ambivalente Rezension: "Es ist äußerst schwierig, genau zu sagen, welchen Platz in der Literatur Mr. James Joyce einnehmen wird. Dass seine Position einzigartig ist, kann kaum bezweifelt werden; aber diese Aussage hilft uns praktisch nicht mehr als die Erklärung vieler beim Erscheinen von Ulysses, dass das Buch 'europäisch' sei und dass Herr Joyce, indem er es schrieb, Eingang in die europäische Literatur gefunden habe."
Vor hundert Jahren war es für einen irischer Autoren nicht unbedingt erstrebenswert, ein "europäisches" Buch geschrieben zu haben. Vor allem wenn sich der Autor aus dem selbstgewählten Exil über seine Landsleute lustig machte. 1912 hatte Joyce die Enge Irlands verlassen, um seine modernen literarischen Experimente anderswo zu betreiben. Von Zürich und Triest aus verfolgte er die politischen Entwicklungen in seinem Heimatland mit großem Interesse, aber auch mit Spott für seine daheim gebliebene Künstlerkollegen. Schon vor der Gründung des irischen Staates sahen sich viele von ihnen im Dienst eines neuen "Celtic Revival", um eine neue irische nationale Identität zu gestalten.
Joyce war nicht überzeugt: weder vom Traum einer neuen Gesellschaft idealisierter edler Bauern noch von Freiheitskämpfern als Politiker. Seine Ablehnung wurde immer bissiger, nachdem Irlands geistesarme, aber politisch klug taktierende Bischöfe das von den Briten hinterlassene Machtvakuum schnell gefüllt hatten. Ob als britische Untertanen oder als freie Bürger, ein Land der "dankbar unterdrückten" Iren, wie Joyce seine Landsleute nannte, werde vor die Hunde gehen, "solange sie ihrer Herrin, der irischen katholischen Kirche, weiterhin treu dienen".
Heute kann man ihm recht geben, aber vor hundert Jahren galten solche Ansichten als Kampfansage. Als der Dichter und Senator William Butler Yeats versuchte, Joyce und dessen "Ulysses" im Oberhaus des irischen Parlaments zu verteidigen, wurde er von allen Seiten angegriffen: Joyces Buch sei nicht zu verteidigen, meinte ein Labour-Politiker, da es einen gewaltsamen Angriff auf die irische Identität darstellte, indem es deren konservative, katholische und antiintellektuelle Grundhaltung kritisierte. Der Parlamentarier fuhr fort: "Ich überlasse es diesem Haus, zu beurteilen, was größere Bedeutung hat: unser christliches Ansehen oder diejenigen, die jeden Anschein des Christentums auf der Erde zerstören würden."
Bis zu seinem Tod wurde Joyce in Irland verfemt. Als er 1941 in Zürich starb, wurde der dortige irische Gesandte aufgefordert, der Trauerfeier fernzubleiben. Einem Ersuchen der Witwe um finanzielle Unterstützung einer Überführung des Leichnams wurde nicht entsprochen. Gleich nach Joyces Tod stellte die irische Schriftstellerin Elizabeth Bowen die Gretchenfrage, ob wir als Iren mit der Hilfe dieses Autors und seines Romans bereit seien, "uns selbst zu erkennen". Auch heute kann man diese Frage in Irland nicht unbedingt bejahen.
Heute aber ist der "Bloomsday" in Dublin ein großes Ereignis - ganz anders, als er 1954 zum ersten Mal begangen wurde. Am fünfzigsten Jahrestag von Leopold Blooms Spaziergang durch Dublin folgten ein paar irische Autoren seinen Fußstapfen und betranken sich dabei mächtig. Weiter reichte die Begeisterung für Joyce in jener Zeit noch nicht. Die Missbilligung der katholischen Oberhäupter war noch so stark, dass ein ehemaliger Lehrer von Joyce, ein Jesuitenpriester, über dessen "bedauerlichen Ruhm" klagte. Nicht einmal Irlands Akademiker wagten seinerzeit, sich mit "Ulysses" zu beschäftigen.
1958 wurde eine Bühnenversion von "Ulysses" beim zweiten Dublin Theatre Festival angekündigt - und gleich darauf abgesagt, weil Dublins mächtiger Erzbischof "not amused" war. Es half nichts, dass der verzweifelte Autor Alan McClelland meinte, bei seiner Adaption extra mit einem Priester zusammengearbeitet zu haben. Im katholischen Irland der fünfziger Jahre durfte das Irland von Bloom und Joyce, ein Land masturbierender Lebenskünstler und maskuliner Puffmütter, einfach nicht gezeigt werden.
Die Rehabilitierung ging nur schleppend voran, angeführt von amerikanischen Akademikern. Durch den Besuch von Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 in Irland bekam sie entscheidenden Auftrieb. Seit Jahren war Kennedy dort als Amerikaner irischer Abstammung angehimmelt worden, sein Foto hing neben dem Bild des Papstes und dem Herz-Jesu-Bild. Im Parlament von Dublin angekommen, beschrieb Kennedy sein Schicksal als Nachfahre irischer Auswanderer mit Worten von Joyce, der den Atlantik als "eine Schale bitterer Tränen" bezeichnet hatte. Keines der größeren Länder habe, so Kennedy weiter, die Welt jemals mit mehr literarischem und künstlerischem Genie beschenkt als Irland.
Sein Wort hatte Gewicht, und Irland wurde langsam zum Literaturland. Als von den sechziger Jahren an die Schul- und Universitätsbildung für alle zugänglich wurde, war es keine Schande mehr, sich Joyces Bildungsromanen und Literaturexperimenten anzunähern. In Dublin hörte man keinen Widerspruch, als der Autor und Literaturwissenschaftler Seamus Deane schließlich vollmundig feststellte: "'Ulysses' ist der erste Roman, in dem die Aktivität des Denkens im Mittelpunkt steht."
Auch wenn Joyce zu Lebzeiten in seiner Heimat weder verstanden noch gefeiert wurde, war der selbstbewusste Autor sich sicher, dass seine Landsleute irgendwann einmal Denkmäler für ihn errichten würden. Heute ist das tatsächlich geschehen. Nur sind hundert Jahre nach Erscheinen des "Ulysses" viele Iren immer noch damit beschäftigt, wie der Joyce-Biograph Richard Ellmann 1959 schrieb, die Zeitgenossen des Autors zu werden. Wir arbeiten weiterhin daran, die irische Identität zu öffnen und zu liberalisieren und uns von dem zu befreien, was uns belastet und was Joyce 1922 in "Ulysses" zu Recht angeprangert hat: Konservativismus, Nationalismus, Klerikalismus und andere Arten der Autoritätshörigkeit. In diesem Sinne bleibt Joyce - auch siebzig Jahre nach seinem Tod - ein guter Wegbegleiter hin zu einer europäischen irischen Identität.
Viele Iren haben mittlerweile gelernt, das Buch zu lieben. Sogar Regierungsvertreter. Irlands derzeitiger Botschafter in Washington, Dan Mulhall, seit Jahren glühender "Ulysses"-Fan, hat gerade einen Ratgeber herausgebracht, der erklärt, wie man das Buch am besten meistert. Paschal Donohoe, Irlands Finanzminister und Präsident der Eurogruppe, hat mir neulich in Berlin erzählt, dass er es 2021 endlich geschafft habe, "Ulysses" zu lesen: "Dabei hatte ich das seltsame und seltene Gefühl, in der Gegenwart eines Genies zu sein."
Ich als irischer Europäer in Berlin sehe allerdings mit Bedauern, wie zum hundertsten Geburtstag dieses Romans bei uns weder der Inhalt von "Ulysses" noch Irlands damalige Ablehnung im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Wie John McCourt im seinem neuen Buch "Consuming Joyce" argumentiert, werde "Ulysses" heute in der Heimat des Schriftstellers oft nur gefeiert, weil die Iren das Werk "von seinem Inhalt befreit haben, von seinem subversiven Potenzial als Mittel, um die irische Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart zu lesen". "Ulysses" wurde konzipiert, um der irischen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Heute haben die Iren es zur Werbetafel für Literaturtourismus umfunktioniert. Ironie der Geschichte? Vielleicht würde Leopold Bloom, vom Beruf Werbemann, diesen Umgang mit "Ulysses" sogar billigen.
Derek Scally ist Deutschlandkorrespondent der Irish Times in Berlin.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Euphorisch bespricht Florian Welle dieses von SWR und Deutschlandfunk gestemmte "Ulysses"-Hörspielprojekt, das auf 23 CDs aus jedem Kapitel des Jahrhundertromans ein eigenständiges Hörspiel machte. Klaus Buhlert, so der Rezensent, ist ein Hörspielregisseur, der von der Musik kommt und darum für das Genre bestens geeignet ist, zumal auch James Joyce bekanntlich ein höchst musikalischer Romancier sei. Geholfen wird Buhlert von einem höchst prominenten Schauspielerensemble. Höhepunkt ist für Welle der Monolog der Molly Bloom, die von Birgit Minichmayr als "schmollmundig vor sich hin Schnoddernde" gegeben wird. Begeistert nimmt Welle auch das über hundertseitige Begleitheft zu dieser großen Edition auf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Man muss den "Ulysses" vielleicht nicht lesen, aber man sollte ihn unbedingt hören."
"Und jedes der achtzehn Kapitel singt [...] anderts und riecht anders und knarzt anders."
"Die Produktion hat eindeutig Suchtpotential." Frankfurter Allgemeine Zeitung