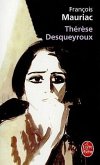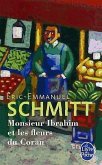Eines Abends, im Januar 2008, wird Frédéric Beigbeder mitten in Paris wegen Drogenkonsums in der Öffentlichkeit festgenommen. Die Polizisten wissen zwar sofort, wen sie da vor sich haben, in diesem Fall aber spielt Beigbeders Prominenz eine besondere Rolle. Sie statuieren ein Exempel und nehmen ihn achtundvierzig Stunden in Untersuchungshaft. In der Haftzelle hat der Autor eine Menge Zeit, über sich, sein Leben, seine Identität, seine Kindheit und seine Familie nachzudenken.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dem französischen Tausendsassa Frédéric Beigbeder ist alles Ernsthafte suspekt. Sein neuer Roman aber ist eine überraschend nachdenkliche Reflexion über zwei ungleiche Brüder.
Von Sandra Kegel
Charles und Frédéric Beigbeder sind Söhne aus gutem Hause. Geboren im schicken Neuilly-sur-Seine, besuchten die Brüder nur die besten Schulen, und im Jahr 2000 hatten sie, Mitte dreißig, ihren ersten großen Erfolg: Charles wurde mit dem Verkauf seiner Internetfirma über Nacht zum Milliardär. Der ein Jahr jüngere Frédéric schrieb "99 francs", einen Roman über das Innenleben der Werbebranche, in der er gearbeitet hatte, und landete prompt einen Bestseller. Acht Jahre später kommt es in der kalten Nacht des 28. Januar 2008 in beider Leben abermals gleichzeitig zu einem schicksalhaften Moment. Just während Charles erfährt, dass ihn Präsident Sarkozy für seine Dienste zur Entwicklung der französischen Wirtschaft zum Ritter der Ehrenlegion ernennen wird, landet der kleine Bruder im Polizeipräsidium des achten Arrondissements - "in einem zwei Quadratmeter großen Käfig mit Wänden voller Graffiti, getrocknetem Blut und Rotz".
Frédéric Beigbeder, den man gerade dabei erwischt hatte, wie er sich von der Kühlerhaube eines Chryslers eine Prise Kokain in die Nase zog, wusste nicht, was als Nächstes passieren würde, und konnte schon gar nicht ahnen, dass er wenige Tage später bei der Ordensverleihung mit seinem Bruder im Elysée-Palast sein würde. Im Kerker konnte er nur den einen Gedanken fassen: "Gott glaubte an meinen Bruder, mich hatte Er verlassen." Die unverhoffte Nacht auf einer kalten Zementbank aber gibt ihm den Anstoß zu autobiographischen Reflexionen und führt ihn in eine achtundvierzigstündige Meditation über die eigene Kindheit und Familie, seine großbürgerliche Herkunft, mit der er seit jeher hadert, und schließlich hin zu den ewig bohrenden Fragen, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum das Dazwischen so kompliziert ist.
Was ihm dazu in den Sinn kommt, ist keinesfalls gefällig. Wie es geschehen kann, dass zwei Menschen, die einander als Kinder so nah waren, als Erwachsene solch gegensätzliche Lebenswege einschlagen, ist die zentrale Frage, die auf zweihundertfünfzig Seiten wieder und wieder gedreht und gewendet wird, freilich ohne zuletzt eine befriedigende Antwort zu finden.
"Ein französischer Roman" hat Beigbeder sein Buch gewohnt unbescheiden genannt. Im vergangenen Jahr ist es in Frankreich erschienen und wurde mit dem renommierten Prix Renaudot bedacht. Zur Frankfurter Buchmesse liegt es in Brigitte Großes zuverlässiger Übersetzung auch auf Deutsch vor. Es ist ein überraschend ehrliches Buch, in dem der Autor sich nicht im mindesten schont, obwohl er in Frankreich zu den großen Medienstars zählt - dauerpräsent bis über die Grenze der Erträglichen hinweg. Denn er schreibt längst nicht mehr nur Bücher, sondern tritt auch als Literaturkritiker auf, moderiert Fernsehsendungen, leitete einen Verlag und kann neuerdings sogar eine Vita als Romanfigur vorweisen. Im aktuellen Lieblingsbuch der Franzosen, Michel Houellebecqs Betrachtung des Kunstbetriebs, "La carte et le territoire", taucht er als koksender Schriftsteller auf.
Der frühere Werbetexter, der es mit geschulter Eleganz versteht, stets Werbung für sich selbst zu machen, fand sein Markenzeichen im Tabubruch und jeder möglichen Form von Protest. Wie bei Rebellen nicht unüblich, zumal in Frankreich, wurde er darüber zum Popstar. Er selbst nennt sich einen Gauche-Kaviar, um sich bewusst von jenen Linksintellektuellen abzugrenzen, die ihre Privilegien herunterspielen. Vielmehr hält er es mit Balzac, der den Hass auf die Bourgeoisie selbst wiederum als bourgeois bezeichnete.
Beigbeders Vorsatz, über alles zu schreiben, worüber man nicht schreiben darf, oder zumindest so zu schreiben, wie es nicht opportun ist, scheiterte allerdings 2004 gehörig, als er mit einem Roman über den 11. September eine literarische Geschmacklosigkeit ersten Ranges ablieferte. Jetzt meldet er sich, dem jede Ernsthaftigkeit angeblich immer verdächtig war, ausgerechnet mit diesem überraschend ernsten und nachdenklichen Buch zurück.
Dabei ist "Ein französischer Roman" keineswegs frei von Eitelkeiten, Beigbeder erscheint auch hier immer wieder als der eloquente Narziss, der im Roman sogar persönlich Rache nimmt an jenem Staatsanwalt, der ihm die literarisch so ergiebige Nacht überhaupt erst ermöglicht hat - und die ihn mit Voltaire, Cervantes oder Casanova in den Club der gefangenen Dichter befördert. Noch vor dem Erscheinen der französischen Erstauflage hatte der strenge Staatsanwalt, Jean-Claude Marin, den Autor dazu gebracht, drei Seiten zu streichen.
Der Tonfall des Buchs ist bewegend und witzig zugleich, elegant und luzide. Der Spötter Beigbeder, der stets Zuflucht in der Ironie suchte, zeigt sich hier, in der Mitte seines Lebens, erstaunlich offen und verletzlich. Natürlich besteht das große Drama dieser Biographie letztlich darin, dass es gar kein wirkliches Drama gibt, sondern vor allem eine beschützte, behütete Kindheit, die in all ihren Höhen und Tiefen gänzlich unoriginell bleibt und sich durch das Fehlen von Unglück von anderen Lebenswegen unterscheidet: "Eine lange Reihe langweiliger, öder, trüber Tage, eintönig, wie die Wellen am Strand." Beigbeder verspottet sich als Dandy aus jener gesellschaftlichen Gruppierung, die wie keine andere das Oberflächliche, das medial Verkommene und die arrogante Leere verkörpert.
Tragödien sind in dieser Familie vor allem selbstgemacht: etwa der Neid des kleinen Frédéric auf den klugen, geliebten, ja perfekten Bruder, der ihm dadurch die Existenz im Unperfekten zuwies und ihm keine andere Möglichkeit ließ, als das enfant terrible der Familie, des Literaturbetriebs, ja der ganzen Nation zu werden. Auch die Scheidung der Eltern schlug eine Wunde, die nie verheilte. Während ein Urgroßvater im Ersten Weltkrieg fiel, andere Vorfahren während des Vichy-Regimes Juden versteckten, kann der Nachfahre im einundzwanzigsten Jahrhundert an Zivilcourage allenfalls vorweisen, sich auf der Suche nach dem einen flüchtigen Glück zu vergiften und für sich das Recht in Anspruch zu nehmen, sich "die Flügel zu versengen", tief zu fallen, abzustürzen.
Erstaunlich, geradezu erschreckend ist es, dass es dem Ich-Erzähler in der achtundvierzig Stunden dauernden Rekapitulation des eigenen Lebens nicht gelingt, sich an die Kindheit zu erinnern. Vielmehr findet er dort, wo andere ihre privates Kraftreservoir haben, nur ein "schwarzes Loch". "In mir ist nichts von mir übrig", fasst er sein Leben bis zum fünfzehnten Geburtstag zusammen. Erst als er die Geschichte und Geschichten der Großeltern und Eltern ausleuchtet, entstehen allmählich Bilder. Wie mit unsichtbarer Zaubertinte geschrieben und nun erhitzt, formen sich plötzlich Schemen des Lebens. Und so ist der Titel, der auf Emmanuel Carrères "Un roman russe" anspielt, nicht einmal vermessen. Denn wie diese Erzählung über eine französische Familie, die zugleich die Umbrüche und Entwicklungen der Fünften Republik behandelt, verlässt auch sein Text das Private. Sein Leben lang habe er sich davor gedrückt, dieses Buch zu schreiben, behauptet Beigbeder gegen Ende. Hätte er bloß noch den Mut gehabt, auf die finale Versöhnung mit sich und der Welt zu verzichten.
Frédéric Beigbeder: "Ein französischer Roman". Roman. Aus dem Französischen von Brigitte Große. Piper Verlag. München, Zürich 2010. 253 S., geb. 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main