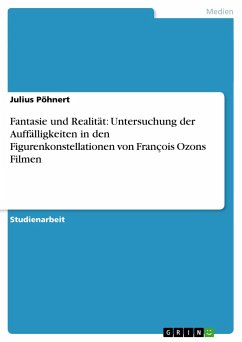Der Band versammelt Aufsätze, die Jacques Rancière seit Mitte der 90er Jahre für die französischen Filmzeitschriften Cahiers du Cinéma und Trafic geschrieben hat. In Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Regisseuren wie Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano oder Pedro Costa, aber auch mit Klassikern wie Robert Bresson, John Ford und Charlie Chaplin erweitert Rancière das Spektrum seiner politischen Filmästhetik, die sich zentral am Begriff der Fiktion entfaltet. Im Namen der politischen Fiktion polemisiert Rancière dabei gegen jene "Infra"- und "Ultra"-Fiktionen, die das Kino im Regime des Konsens einsperren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Spät kommt das Kino, ist aber dafür absolut modern: Eine Auswahl von Texten zum Film zeigt Jacques Rancière als Beobachter mit Sinn für Details
Für manche französischen Philosophen gehört es beinahe zum guten Ton, irgendwann im Lauf der Karriere ein Buch zum Kino herauszubringen. Alain Badious einschlägige Texte wurden kürzlich gesammelt veröffentlicht, auch Clement Rosset hat sich zum Kino "geäußert"; Jean-Luc Nancys "Die Evidenz des Films" liegt schon eine Weile auf Deutsch vor, und dann gibt es natürlich noch das Zentralgebirge in diesem Bereich, die zwei Bände von Gilles Deleuze.
Bei Jacques Rancière verhält sich die Sache so, dass er eine Reihe von größeren Texten zum Thema schon vor zehn Jahren zu dem Band "La Fable cinémathographique" zusammengestellt hat, von dem seit langem eine deutsche Übersetzung erwartet wird. Solange diese noch nicht erschienen ist, kann man sich nun mit einem kleineren Band beschäftigen, der eine lose Reihe von Texten enthält, die Rancière zwischen 1998 und 2001 für die "Cahiers du Cinéma" verfasste: Er enthält im Grunde Gelegenheitsarbeiten, geht dabei aber von jenen Gelegenheiten aus, die in dieser Fülle nur die Kinostadt Paris bietet: von John Ford bis Abbas Kiarostami, von Robert Bresson bis Pedro Costa, von Kenji Mizoguchi bis Takeshi Kitano reicht der Bogen des Regisseure, von deren Arbeiten Rancière sich inspirieren ließ. Die entsprechenden Texte sind meist nur ein paar Seiten lang, umso bemerkenswerter ist, wie gut hier die Verbindung der beiläufigen Beobachtung mit dem offenen System gelingt, das Rancière über die Jahre entwickelt hat.
Als Filmkritiker ist er deswegen so lesenswert, weil er mit seiner Unterscheidung zwischen einem "repräsentativen" (im weitesten Sinne regelpoetischen) und einem "ästhetischen" (konsequent ausdrucksoffenen) Regime (nicht nur) in den Künsten einen Ansatz entwickelt hat, der es ihm erlaubt, die Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen - Theater, Literatur, Bildende Künste, Film - zusammenzudenken, ohne sie deswegen auf eine gemeinsame Linie bringen zu müssen. Im Gegenteil denkt er das Kino besonders pointiert von seiner spezifischen Verspätung her als ein Medium und eine Kunst, die just in dem Moment auftauchten, als die anderen Künste sich gerade anschickten, "modern" zu werden.
Rancière stellt an den Filmen nun nicht, wie es traditionell in der Kritik häufig geschah, einen Mangel an Modernität fest, sondern dreht die Sache um: "Das Kino ist der privilegierte Ort, an dem der modernistische Glaube, dass die Künste zu ihrer Vollendung fänden, wenn sie in der Reinheit ihre Autonomie erlangten, seinen Irrtum erkennen musste." Das Kino ist für ihn vielmehr "die populäre Form des ,Gesamtkunstwerks", und in dessen Geschichte und Kritik kommt es gerade darauf an, das ständige Durcheinanderlaufen der Logiken der Repräsentation und der Autonomie zu begreifen.
Der für Rancière zentrale Begriff des "Repräsentativen" lässt sich auf sehr viele Phänomene beziehen, politisch nicht zuletzt auf ein Einvernehmen über das Funktionieren eines Gemeinwesens, das einer immer wieder neuen "Aufteilung des Sinnlichen" entgegensteht. Im Bereich des Kinos wären Phänomene des Repräsentativen solche, die vielfach mit den klassischen Studiosystemen zu tun haben: die Ausprägung von Genres, die Berechenbarkeit von Starerscheinungen, neuerdings die Verfolgbarkeit exemplarischer Figuren in den Kontexten lang laufender Serien.
Deren Boom hatte Rancière schon vor Augen, bevor er tatsächlich abzusehen war. Das liegt daran, dass er in der Entwicklung des Romans im neunzehnten Jahrhundert ein Modell sieht, das nach wie vor Relevanz hat: Die Spannung zwischen Flaubert und Eugène Sue durchzieht noch ein hochgelobtes Werk wie "The Wire", das zwischen "signifikantem Beispiel" und "Isolierung eines kritischen Moments" ungeahnte Formen des Suspense entwickelt hat. Interessanterweise lassen sich Rancières kleine Schriften zum Film deutlicher noch als seine "Filmfabeln" zwar als eine Überwindung der großen dichotomischen Ästhetiken lesen (der Romantheorie von Lukács, der Filmtheorie von Deleuze); ihr Nutzen liegt aber gerade auch darin, dass er seinerseits eine strukturierte Antiteleologie anbietet, also auch ein Zweistufenmodell, auf dessen Grund immer noch ganz deutlich das Wechselspiel zwischen Klassizität und Modernität erkennbar ist.
Entscheidend ist, wie er dieses Modell immer wieder "durchkreuzt", um einen seiner Lieblingsbegriffe zu verwenden. So findet er etwa in dem kuriosen Detail der "unpassenden Beinstellungen" Henry Fondas bei John Ford (er legt in Cowboy-Manier mehrfach seine Beine hoch) eine Geste der Emanzipation vom Rollenidol, dem ein Film wie "Young Mr. Lincoln" vorwiegend dient. Das mag ein wenig weit hergeholt erscheinen, überzeugt aber in der größeren Linie von Beobachtungen, die sich durch diesen Band ziehen und die allesamt darauf hinauslaufen, einem zu kurz gedachten sozialen Realismus ein Element des "Nicht-Wiedererkennbaren" entgegenzusetzen. Diesen Blick einzuüben, dazu können die Texte dieses Bandes helfen. Er darf, obwohl vorgeblich den "Zufällen der Aktualität" geschuldet, als eines der wichtigsten neueren Bücher zum Film gelten.
BERT REBHANDL
Jacques Rancière: "Und das Kino geht weiter". Schriften zum Film.
Hrsg. von Sulgi Lie und Julian Radlmaier. Aus dem Französischen von Julian Radlmaier. August Verlag, Berlin 2012. 176 S., Abb., br., 14,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als eines der wichtigsten neuen Bücher zum Film bezeichnet Bert Rebhandl diesen schmalen Band mit Texten, die Jacques Rancière zwischen 1998 und 2001 für die "Cahiers du Cinema" verfasst hat. Über eine bloße Vertröstung bis zur angekündigten Übersetzung von Rancières "Filmfabeln" geht der Band laut Rebhandl hinaus, der den Autor jeweils auf ein paar Seiten nur, doch, wie Rebhandl findet, unnachahmlich über Arbeiten von John Ford oder Takeshi Kitano philosophieren lässt. Zweierlei ist für den Rezensenten bemerkenswert: Rancières besonderes Verständnis des Kinos als zwischen Repräsentation und Autonomie changierendes Gesamtkunstwerk. Und die Darbietung eines eigenen Modells, das immer wieder die bekannten ästhetischen Dichotomien durchkreuzt, indem es den Leser auf die kleinen Exaltationen im filmischen Realismus hinstößt. Dafür ist Rebhandl dankbar.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH