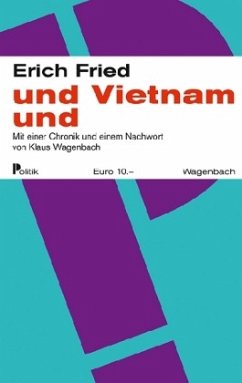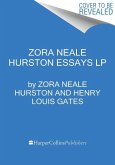"und Vietnam und" - das sind Elegien, Sprüche, Maximen, Proteste gegen einen amerikanischen Krieg im Namen der Freiheit, der zum Trauma nicht nur einer Nation, sondern einer ganzen Generation wurde. Es sind "engagierte" Gedichte, die neue lyrische Formen erfanden. Diese damals ungewohnte Hineinnahme des lyrischen Ich ins politische Handgemenge blieb nicht ohne Folgen. Obwohl dem Buch - auch das ungewohnt - eine "Chronik" der Fakten des Krieges beigegeben worden war, wurde es zu einem höchst "umstrittenen".
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Abnehmende Dringlichkeit, schrumpfende Bedeutung - Erich Frieds Gedichte
Am 24. April 1967 erschien im "Spiegel" ein Artikel des Schriftstellers Peter Rühmkorf über den Gedichtband "und Vietnam und" von Erich Fried. Die großen Zeitungen hatten diese Gedichte, als sie einige Monate zuvor veröffentlich worden waren, gar nicht besprochen: nicht die F.A.Z., nicht die "Zeit" oder die "Frankfurter Rundschau", nicht die "Welt" und die "Süddeutsche" in einer Sammelbesprechung in nur vier Zeilen. Jetzt kam der 37-jährige Rühmkorf und lobte die politische Lyrik des acht Jahre älteren Fried, der 1938 aus Österreich nach London emigriert war, um im gleichen Atemzug auf die einnehmendste Weise gegen Günter Grass zu polemisieren: "Wo die Welt des Günter Grass ihre Grenzen hat und die Einsicht auch unserer anderen Kaiserwilhelmgedächtniskirchturmpolitiker endet", schrieb er, "beginnt die Wahrnehmungszone der Gedichte von Erich Fried". Dieser Mann gehöre nun tatsächlich zu jener viel beschriebenen, im Grunde sagenhaften und konkret nur in einigen drei, vier, fünf, sechs Exemplaren nachweisbaren Gattung "dichtender Diversanten", denen der scheinbar abgelegene Krieg in Südostasien ein naheliegender, das heißt: ein paradigmatischer Vorwurf auch fürs Schreiben sei. Anders als Grass, für den Vietnam, "schön goethisch", weiter als "hinten weit in der Türkei" zu liegen scheine - gerade so, als ob sich im Zeitalter interstellaren Raketenverkehrs noch über "Krieg und Kriegsgeschrei" verhandeln ließe wie zu den Tagen des "Marschall Vorwärts" -, sehe Fried "im Vietnam-Krieg die dringende Mord- und Brandsache".
Ein Jahr davor hatten die Mitglieder der "Gruppe 47" in Princeton getagt und sich darüber gestritten, was man dem Gastland, den Vereinigten Staaten, zumuten dürfe. Vorab hatten sie sich verpflichten müssen, keine offiziellen politischen Resolutionen zu verfassen. Und es waren dann nur vier Schriftsteller, die sich vor Ort mit dem "Read-in for peace" ihrer amerikanischen Schriftstellerkollegen solidarisierten: Peter Weiss, Hans Magnus Enzensberger, Reinhard Lettau und Erich Fried - zwei Emigranten und zwei Autoren, die lange im Ausland lebten oder gelebt hatten. Diese vier beschimpfte Grass in seiner Princetoner Rede, in der "ich mich ganz und gar provinziell an deutsche Verhältnisse klammere", als "Hofnarren" und attackierte in seinem 1967 erschienenen Gedichtband "Ausgefragt" dann auch direkt die Gedichte Frieds, in denen "verschleppter Stimmbruch der Twens / von Liebe und fernem Krieg / in Vietnam flugstundenweit klagt".
Und es ist gar keine Frage, wo, von heute aus betrachtet, die eigenen Sympathien liegen, wie abstoßend einem der kleinkarierte Günter Grass erscheint und wie wunderbar wortmächtig Peter Rühmkorf, wenn er Erich Fried gegen die engen Grenzen der Grass-Welt verteidigt. Wenn man "und Vietnam und" dann aber liest, entsteht ein seltsamer Effekt. Den Gedichten ist eine Chronik der Ereignisse in Vietnam beigegeben und auf der Titelseite innen im Buch auch eine Landkarte: "Das Land liegt sieben Fußtritte / und einen Schuss weit", heißen die ersten Zeilen eines Gedichts, das wie eine Art Vorrede den anderen vorangestellt ist und in dem gleich klar wird, worum es Fried in seiner politischen Lyrik geht: Die Frage nach dem, was in Vietnam wirklich geschieht oder geschehen ist, tritt bei ihm zurück. Er unternimmt nicht den Versuch, das zu reproduzieren. Zentral ist vielmehr, wie man benennt, was geschieht, und wie das, was geschehen ist, von anderen benannt wird. So werden seine Gedichte zu einem Ort der Selbstreflexion politischen Sprechens.
Nur kommen sie mit einem Gestus der Dringlichkeit daher, der, wenn man sie heute liest, eher den gegenteiligen Effekt hat. Die Wiederholungen, diese eingängige Art, Dinge immer wieder zu sagen und nur manchmal mit kleinen Abweichungen nämlich, schafft Distanz: "Weil das alles nicht hilft / Sie tun ja doch was sie wollen / Weil ich mir nicht nochmals / die Finger verbrennen will" und die sieben weiteren "Weils", die folgen, wirken heute genauso wie die alle mit "Als" beginnenden Zeilen des Gedichts "Der Freiwillige": Sie führen eher zu einer Entleerung von Bedeutung, als dass sie einen die Dringlichkeit von Bedeutung erfahren ließen.
JULIA ENCKE.
Erich Fried: "und Vietnam und". Wagenbach, 90 Seiten, 10 Euro (erscheint in einer neuen Ausgabe am 9. März)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main