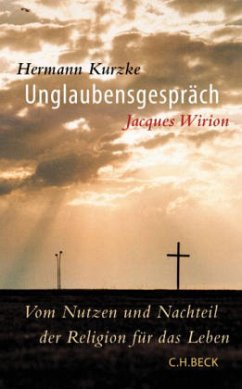Vom Nutzen und Nachteil der Religion für das Leben
Wozu nützt Religion? Sie hilft gegen Zufall, Leid und Tod, sagt der eine. Illusion! sagt der andere. Was ist intellektuell noch erlaubt, wenn man die Religionskritik ernst nimmt? Religion ist Opium, das mag sein - aber ist das Leben ohne Opium zu ertragen, sind nicht auch Musik und Fernsehen Opium? Ist heroischer Nihilismus angesagt, oder darf es ein postmodernes Christentum geben, das nur noch nach dem Trost, nicht mehr nach der Wahrheit fragt? Ist Christentum dann ein bloßes Therapeutikum, ein intellektuelles Sofa, auf dem sich die Denkfaulheit ausruht? Oder ist Christsein im Gegenteil ungesund? Erzeugt die christliche Nächstenliebe Neurosen? Oder ist sie letzten Endes sogar eine subtile Form von Egoismus? Kann man den Trost der Religion gewinnen, ohne sich selbst zu betrügen? Gibt es Frömmigkeit ohne Glauben?
Ein nicht mehr ganz gläubiger Christ und ein nicht ganz ungläubiger Atheist streiten über Fragen der Religion und der Lebenskunst. Es geht um Glück und Leid, Kunst und Leben, Gesundheit und Krankheit, Zufall und Tod, Gott und die Welt.
Wozu nützt Religion? Sie hilft gegen Zufall, Leid und Tod, sagt der eine. Illusion! sagt der andere. Was ist intellektuell noch erlaubt, wenn man die Religionskritik ernst nimmt? Religion ist Opium, das mag sein - aber ist das Leben ohne Opium zu ertragen, sind nicht auch Musik und Fernsehen Opium? Ist heroischer Nihilismus angesagt, oder darf es ein postmodernes Christentum geben, das nur noch nach dem Trost, nicht mehr nach der Wahrheit fragt? Ist Christentum dann ein bloßes Therapeutikum, ein intellektuelles Sofa, auf dem sich die Denkfaulheit ausruht? Oder ist Christsein im Gegenteil ungesund? Erzeugt die christliche Nächstenliebe Neurosen? Oder ist sie letzten Endes sogar eine subtile Form von Egoismus? Kann man den Trost der Religion gewinnen, ohne sich selbst zu betrügen? Gibt es Frömmigkeit ohne Glauben?
Ein nicht mehr ganz gläubiger Christ und ein nicht ganz ungläubiger Atheist streiten über Fragen der Religion und der Lebenskunst. Es geht um Glück und Leid, Kunst und Leben, Gesundheit und Krankheit, Zufall und Tod, Gott und die Welt.
'Eine höchst informative Studie ... fügen sich die 25 Einzelbeiträge zu einem einheitlichen Ganzen: einer politischen, Kirchen-, Kultur- und Sozialgeschichte Bayerns im europäischen Rahmen, die den Fachhistoriker, den an Geschichte interessierten Laien und den (selbst-)kritischen Bayern-Fan gleichermaßen vorzüglich bedient.' Norbert H. Ott, Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Die Religion im Zeitalter der Moderne aus philosophischer Sicht beschäftigt Hermann Kurzke und Jacques Wirion in diesem Briefwechsel, der über vier Jahre geführt wurde. Für Antje Schrupp zeigt die Diskussion zwischen dem Christen und dem Atheisten abgesehen vom "Ringen" zweier bürgerlicher Gelehrter um die Berechtigung von Religion auch die Entstehung einer "schönen Männerfreundschaft", in deren Verlauf die Frage, wer recht hat, immer unbedeutender wird. Aber zurück zum Problem. Kurzke versucht die Religion angesichts des Schwindens der Glaubensgewissheit mit ihren nützlichen Aspekten wie der Bereitstellung von Sinn und Trost zu legitimieren. Wirion zeiht ihn der Feigheit und plädiert dafür, Sinnlosigkeit und Zufall zu akzeptieren. Aus dem drohenden Patt führt Kurzke heraus, indem er Sinn und Trost als kulturelle Errungenschaften des Menschen versteht, die nicht unbedingt metaphysisch existieren müssten. Aber jeder könne für sich entscheiden, ob er mit ihnen oder ohne sie leben möchte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH