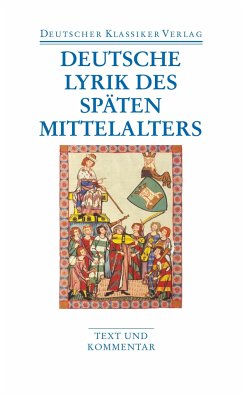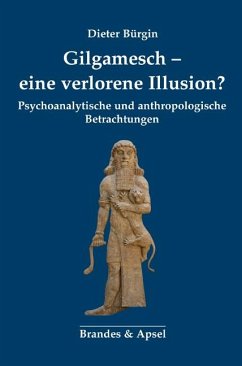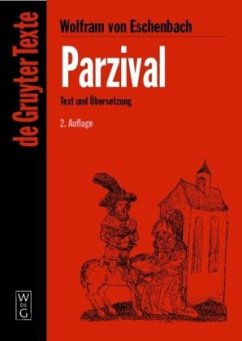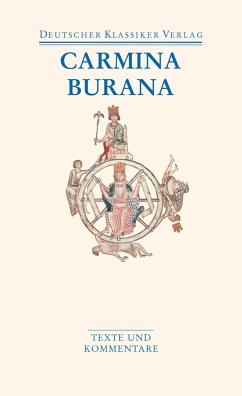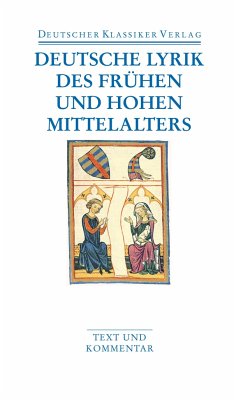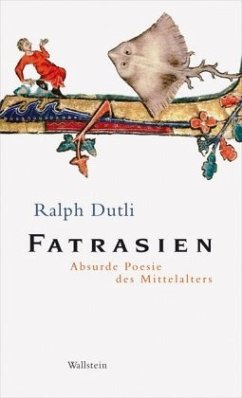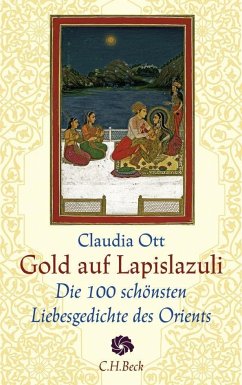Unmögliche Liebe
Die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen. Zweisprachige Ausgabe
Herausgegeben: Wagner, Jan; Marquardt, Tristan
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Diese besondere Anthologie ist ein hehres Liebesbekenntnis der Dichter der Gegenwart zu ihren großen Vorfahren im Mittelalter. Lyriker wie Monika Rinck oder Joachim Sartorius, Durs Grünbein oder Nora Gomringer haben Minnelieder aus dem Mittelhochdeutschen übertragen. Die Herausgeber Jan Wagner und Tristan Marquardt laden damit ein, alle großen Dichter des Hochmittelalters kennenzulernen. In diesen Gedichten betreten wir nicht nur ein über achthundert Jahre altes Neuland, eine Welt, deren Begehren uns nah und fremd zugleich erscheint. Die fantastisch unterschiedlichen Übersetzungsweisen d...
Diese besondere Anthologie ist ein hehres Liebesbekenntnis der Dichter der Gegenwart zu ihren großen Vorfahren im Mittelalter. Lyriker wie Monika Rinck oder Joachim Sartorius, Durs Grünbein oder Nora Gomringer haben Minnelieder aus dem Mittelhochdeutschen übertragen. Die Herausgeber Jan Wagner und Tristan Marquardt laden damit ein, alle großen Dichter des Hochmittelalters kennenzulernen. In diesen Gedichten betreten wir nicht nur ein über achthundert Jahre altes Neuland, eine Welt, deren Begehren uns nah und fremd zugleich erscheint. Die fantastisch unterschiedlichen Übersetzungsweisen durch über sechzig heutige Dichter zeigen darüber hinaus, was für Ideen die Gegenwartslyrik heute prägen.