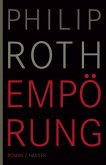Eltern sind auch nur Menschen. Und was macht man mit einem Sohn, der nicht mehr in die Schule gehen möchte? David, der Vater, schlägt Jesse einen ungewöhnlichen Handel vor: freie Kost und Logis, aber drei Filme pro Woche. Von Truffaut über Hitchcock bis hin zu "Basic Instinct". Nachmittage und Abende gemeinsam auf dem Sofa. Kein Kurs in Filmgeschichte, sondern viel Zeit zum Reden über falsche Freundinnen, die richtigen Fehler, verlorene und gefundene Liebe. Und darüber, wie lebenswichtig Leidenschaft ist.
Ein wahres und weises, zärtliches und urkomisches Buch über gebrochene Herzen und gelungene Beziehungen und darüber, dass Erwachsenwerden nichts mit dem Alter zu tun hat.
Ein wahres und weises, zärtliches und urkomisches Buch über gebrochene Herzen und gelungene Beziehungen und darüber, dass Erwachsenwerden nichts mit dem Alter zu tun hat.

David Gilmour kreuzt eine Erziehungsfabel mit einer kleinen Filmkunde. Heraus kommt ein anmutiger Roman.
Von Oliver Jungen
Die wahre Schule des Lebens, hat Truffaut bekanntlich herausgefunden, ist das Kino. Warum dann überhaupt noch in die falsche gehen? Auf diese Idee kann natürlich nur ein Filmkritiker kommen, aber wie es der Zufall will, ist der Kanadier David Gilmour nicht nur ein im englischsprachigen Raum renommierter Schriftsteller, sondern auch Filmkritiker. Nun ist sein vor zwei Jahren im Original publizierter, autobiographisch gefärbter Roman "The Film Club" auf Deutsch erschienen. Darin berichtet ein Erzähler, modelliert ganz offensichtlich nach dem Vorbild des Autors, pointiert über die mit dem sechzehnjährigen Sohn Jesse verbrachte Zeit, nachdem er diesem erlaubt hat, die Schule abzubrechen.
An die Stelle des weltfremden Lehrplans (Latein!) setzt der Erzähler sich selbst sowie die einzig wahre moralische Anstalt: "Ich will, dass du jede Woche mit mir drei Filme anschaust. Ich suche sie aus. Das ist die einzige Form von Ausbildung, die du bekommst." Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Aus Jesse wird kein korrupter Polizist (Richard Gere in "Internal Affairs"), kein apokalyptischer Rächer (James Caan in "Der Einzelgänger"), kein drogenabhängiges Wrack (Max von Sydow in "Der Exorzist"), obwohl Drogen durchaus eine Rolle spielen. Aus Jesse wird ein einigermaßen erfolgreicher Rapper in einer Jugendband, der sich schließlich von selbst wieder für die falsche, echte Schule entscheidet. Vorher hat er einige Liebeshändel durchzustehen. Kurz: Jesse wird erwachsen.
Diesem an sich nicht gerade aufregenden Plot nimmt Gilmour auch noch jedes Entwicklungs-, will sagen Konfliktpotential, indem er dem idealen Sohn einen idealen Vater zugesellt: Der küsst ihn, aber schlägt ihn nicht. Diese Dyade ergänzen zwei ideale Mütter zur heiligen Familie: Tina, Davids Ehefrau, und Maggie, Davids Exfrau. Alle lieben einander: Wer braucht da Latein? Und so überrascht auch das kursiv gesetzte, väterliche Geständnis nicht: "Mein Gott, was hat er für ein wunderschönes Lächeln." Nichts ist weniger ungewöhnlich als elterlicher Stolz, wie sehr die Brut auch aus der Art schlagen mag. Gibt es aber andersherum etwas, das einem Pubertierenden mehr zuwider sein muss, als von den eigenen Eltern angehimmelt zu werden? Jesse jedoch erträgt nicht nur geduldig alle väterlichen Ratschläge, er erbittet sie sogar ausdrücklich: "Findest du, es stimmt, Dad, dass man eine Frau nicht gleichzeitig haben und wollen kann?"
Ganz uneigennützig ist das Projekt freilich nicht: Auch in Davids Alltag kommt mit dem Lebensdrang des Sohnemanns neuer Schwung. So schimmert denn auch Eifersucht durch, sobald ein Mädchen den Sohn wegzuschnappen droht. Überhaupt wird David nervös, wann immer der Filius vom Radar verschwindet, und sei es, weil er einen Auftritt hat oder mit Kumpeln abhängt. Es wird jeweils ausführlicher Rapport erwartet (und auch berichtet, wie man diesen als Vater am geschicktesten erwirkt).
Den Leseeindruck liefert Gilmour gleich mit: "Man denkt, es geht ewig so weiter, und dann, eines Tages, hört es einfach auf." Das alles ist jedoch mit einer solchen Anmut erzählt, dass der Leser beide Figuren ins Herz schließt, zumal sich David offenherzig gibt. Einmal, nachdem ein Auftrag geplatzt ist, das erwartete Honorar aber schon ausgegeben, bricht er regelrecht zusammen: "Als ich die Spülung drückte, rutschte mir die Uhr vom Handgelenk und wirbelte den Abfluss hinunter. Ich setzte mich auf den Klositz und weinte leise." Es kommt ihm der Gedanke, eigentlich ein "Blender, ein Versager" zu sein. Diese Selbstzweifel plagten ähnlich schon Jesse; Äpfel und Stämme.
Den roten Faden des Buches bilden die Filmvorführungen samt der Kurzeinführungen: ein Propädeutikum der enthusiastischen Filmkunde. Dabei muss man nicht die Einschätzung teilen, dass "Der Exorzist" "die Krönung aller Horrorfilme" und "Showgirls" die schlechteste Produktion aller Zeiten ist. Irgendwann also hört es einfach auf. Der Vater ahnt plötzlich, "dass meine Pechsträhne vorüber war", hat keine geraubten Küsse mehr nötig. Der Sohn zieht mit einem Mädchen davon, muss nach amourösem Schiffbruch aber noch einmal nachsitzen in der Schule des Lebens, Lektion: Kokain ist auch keine Lösung. Jesse also macht sein Sofaabitur, das andere gleich hinterher und bricht auf, die Welt zu erobern - ein bisschen James Dean, ein bisschen Antoine Doinel und ein bisschen Vatersöhnchen.
David Gilmour: "Unser allerbestes Jahr". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Adelheid Zöfel. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2009. 254 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Fritz Göttler traut dem Kinoverständnis des Autors nicht so recht über den Weg. Die beiden ineinander verzahnten Coming-of-age-Geschichten von Vater und Sohn, die David Gilmour in diesem Buch erzählt, hätten es vielleicht auch nicht nötig, dass man Filme heranzieht, um sie besser zu verstehen, legt Göttler nahe. Die vom Vater für den krisengeschüttelten Sohn initiierte Tour durch die Kinohistorie gibt laut Göttler jedenfalls keine Antworten auf die Probleme der Pubertät oder einer veritablen Midlifecrisis.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH