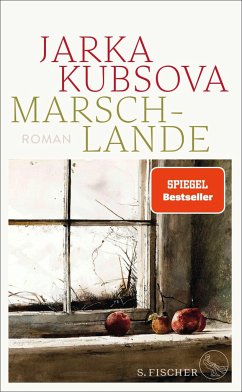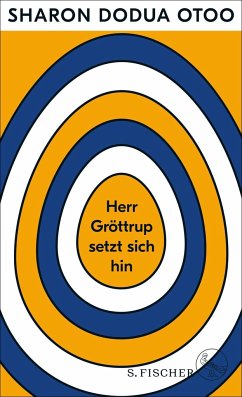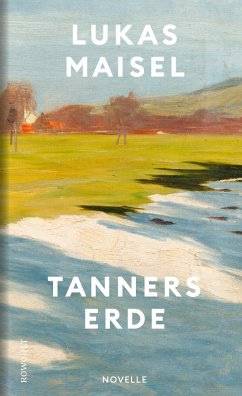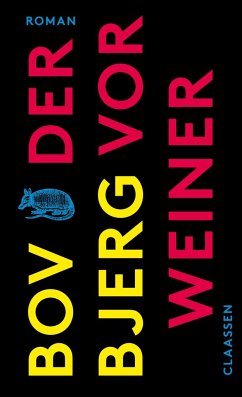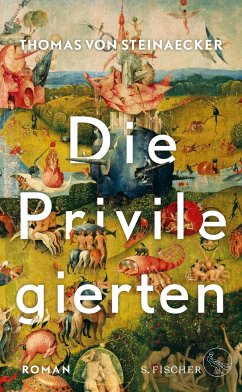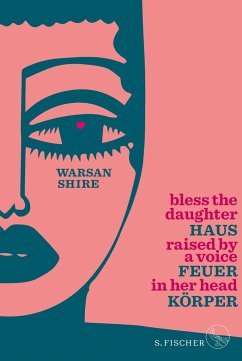-53%12)

Unsere anarchistischen Herzen (Mängelexemplar)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Gebundener Preis: 23,00 € **
Als Mängelexemplar:
Als Mängelexemplar:
10,89 €
inkl. MwSt.
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Zwei junge Frauen: Charles und Gwen. Charles muss mit ihren Post-Hippie-Eltern aufs Land ziehen und will da unter keinen Umständen hin. Auf einen Kiosk, eine Palme und das Internet ist zum Glück noch Verlass. Und Gwen? Sie wohnt ganz in der Nähe und führt dort unbemerkt ein wildes, schmutziges Leben, um dem Wohlstand ihrer Eltern zu entkommen. Das Geld, das sie den Jungs aus der Tasche zieht, während sie mit ihnen schläft, spendet sie. Dass die beiden sich kennenlernen, ist definitiv überfällig. Lisa Krusche erzählt von den Zumutungen des gegenwärtigen Lebens. Wie soll man eigentlich...
Zwei junge Frauen: Charles und Gwen. Charles muss mit ihren Post-Hippie-Eltern aufs Land ziehen und will da unter keinen Umständen hin. Auf einen Kiosk, eine Palme und das Internet ist zum Glück noch Verlass. Und Gwen? Sie wohnt ganz in der Nähe und führt dort unbemerkt ein wildes, schmutziges Leben, um dem Wohlstand ihrer Eltern zu entkommen. Das Geld, das sie den Jungs aus der Tasche zieht, während sie mit ihnen schläft, spendet sie. Dass die beiden sich kennenlernen, ist definitiv überfällig. Lisa Krusche erzählt von den Zumutungen des gegenwärtigen Lebens. Wie soll man eigentlich rebellieren, wenn sich alles schon verloren anfühlt? Was einem bleibt, ist die Freundschaft. Und die entwickelt eine explosive Kraft.
»Lisa Krusche beseelt alles durch ihre starksehnig poetische und quecksilbrig mischfreudige Sprache, und ihr endloser Einfallsreichtum zeigt mir - und den meisten anderen Dichtern deutscher Sprache - wie steinalt und roboterhaft wir inzwischen geworden sind.« Clemens J. Setz
»Lisa Krusche beseelt alles durch ihre starksehnig poetische und quecksilbrig mischfreudige Sprache, und ihr endloser Einfallsreichtum zeigt mir - und den meisten anderen Dichtern deutscher Sprache - wie steinalt und roboterhaft wir inzwischen geworden sind.« Clemens J. Setz
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.