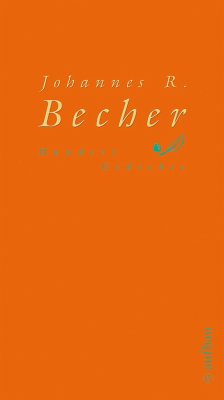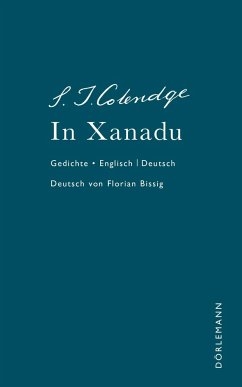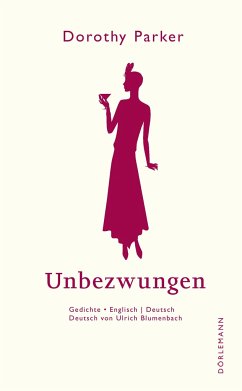Nicht lieferbar

Unsere Spiele enden nicht
Gedichte
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
"HEUTE IM WINTERTRÄUMEN BIN ICH EIN SCHIFF"Heute in Winterträumen bin ich ein Schiff / in einem dunstigen Kanal mit Gegenverkehr.Ist da ein Streifen, wo am Horizont,/ bitte lippenrot, nicht wundenrosa?"Nichts behält seine Gestalt / und nichts geht verloren", heißt es im Auftaktgedicht "An eine Dreizehnjährige" in Dirk von Petersdorffs neuem Lyrikband. Das liebevoll beobachtende, detailreiche, ebenso fein ironische wie unerschrockene Gedicht über die Tochter mit seinem melancholischen Unterton gibt die Stimmung vor für die ganze Sammlung: "Aus deinem Zimmer trage ich / einen Joghurtbeche...
"HEUTE IM WINTERTRÄUMEN BIN ICH EIN SCHIFF"
Heute in Winterträumen bin ich ein Schiff / in einem dunstigen Kanal mit Gegenverkehr.
Ist da ein Streifen, wo am Horizont,/ bitte lippenrot, nicht wundenrosa?
"Nichts behält seine Gestalt / und nichts geht verloren", heißt es im Auftaktgedicht "An eine Dreizehnjährige" in Dirk von Petersdorffs neuem Lyrikband. Das liebevoll beobachtende, detailreiche, ebenso fein ironische wie unerschrockene Gedicht über die Tochter mit seinem melancholischen Unterton gibt die Stimmung vor für die ganze Sammlung: "Aus deinem Zimmer trage ich / einen Joghurtbecher mit Schimmelkultur / und ein Müsli, hart geworden / wie Mörtel: Man könnte ein Haus damit bauen./ Du aber willst kein Haus, sondern auswandern."
Schwellen zum Leben, zum Tode, Abschiede und Ankünfte, alte und neue Liebe, die Gegenstände des Alltags und die der Pop- wie der Hochkultur, August Macke und das Skateboard: Dirk von Petersdorff ist der Lyriker einer unabgeschlossenen Gegenwart, die sich dem Ältesten verwandt fühlt, in ihm aber trotzdem keine rückhaltlose Geborgenheit finden kann. Nachdenklich und im souveränen Umgang mit dem Formenreichtum der lyrischen Überlieferung ein Genuss, feine Fangnetze, die die Transformationen der Gegenwart zu fassen vermögen: Die Gedichte dieses Bandes sind kleine poetische Studien der Verwandlung.
Heute in Winterträumen bin ich ein Schiff / in einem dunstigen Kanal mit Gegenverkehr.
Ist da ein Streifen, wo am Horizont,/ bitte lippenrot, nicht wundenrosa?
"Nichts behält seine Gestalt / und nichts geht verloren", heißt es im Auftaktgedicht "An eine Dreizehnjährige" in Dirk von Petersdorffs neuem Lyrikband. Das liebevoll beobachtende, detailreiche, ebenso fein ironische wie unerschrockene Gedicht über die Tochter mit seinem melancholischen Unterton gibt die Stimmung vor für die ganze Sammlung: "Aus deinem Zimmer trage ich / einen Joghurtbecher mit Schimmelkultur / und ein Müsli, hart geworden / wie Mörtel: Man könnte ein Haus damit bauen./ Du aber willst kein Haus, sondern auswandern."
Schwellen zum Leben, zum Tode, Abschiede und Ankünfte, alte und neue Liebe, die Gegenstände des Alltags und die der Pop- wie der Hochkultur, August Macke und das Skateboard: Dirk von Petersdorff ist der Lyriker einer unabgeschlossenen Gegenwart, die sich dem Ältesten verwandt fühlt, in ihm aber trotzdem keine rückhaltlose Geborgenheit finden kann. Nachdenklich und im souveränen Umgang mit dem Formenreichtum der lyrischen Überlieferung ein Genuss, feine Fangnetze, die die Transformationen der Gegenwart zu fassen vermögen: Die Gedichte dieses Bandes sind kleine poetische Studien der Verwandlung.