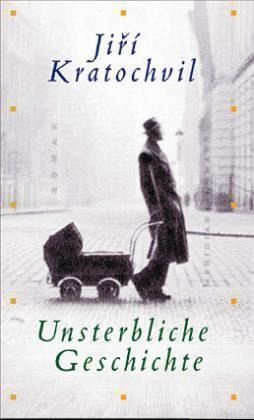Die Protagonistin Sonja Trotzkij-Sammler erzählt ihr Leben: Ihre Geburt am 1. Januar 1900 wird von ihrem (vorbestimmten) - zu diesem Zeitpunkt zwölfjährigen - Liebhaber Bruno Mlock ungedulig erwartet. Doch drei Tage später ertrinkt Bruno in der Donau. Dennoch kehrt er in Sonjas Leben zurück, um sich in Gestalt verschiedener Tierinkarnationen in Liebe mit ihr zu vereinen.
Und dann geschieht plötzlich etwas Merkwürdiges... Sonja wird auserwählt als "verlängerter Finger, mit dem wir eines Tages das einundzwanzigste Jahrhundert und das dritte Jahrtausend berühren werden."
Und dann geschieht plötzlich etwas Merkwürdiges... Sonja wird auserwählt als "verlängerter Finger, mit dem wir eines Tages das einundzwanzigste Jahrhundert und das dritte Jahrtausend berühren werden."

Durchaus verwickelt: Jirí Kratochvils tschechisches Pandämonium
Selten gibt es Bücher, die so deutlich den Höhe- und gleichzeitig Endpunkt einer bestimmten literarischen Richtung zu markieren scheinen wie Jirí Kratochvils "Unsterbliche Geschichte". Denn woran denkt man als Erstes bei der tschechischen Literatur? Man denkt an Bierdunst und verrückte Streiche, an wilde Phantasie, groteske Übertreibung, an so unbändigen wie abgründigen Humor, an das ganze Instrumentarium überschießender Fabulierkunst. Der brave Soldat Schwejk fällt einem ein und Bohumil Hrabal, dieser Volksheld und Erfolgsschriftsteller, der angeblich beim Taubenfüttern vom Dach fiel und starb, ganz als hätte er das für sich so vorgeschrieben.
Wenn man sehr ins Detail geht, erinnert man sich vielleicht sogar daran, dass sich auch Pavel Kohout in "Meine Frau und ihr Mann" kürzlich in der Kunst der phantastischen Parabel versucht hat. Da wurden im Irrenhaus die Patienten in historisch verschiedene Pavillons gesteckt, je nachdem, an welcher Epoche der jüngeren tschechischen Geschichte sie verrückt geworden waren. Wohin man sieht, begegnet einem dieser kreative Wahnsinn. In Michal Vieweghs erstem Roman - Viewegh, geboren 1962, ist einer der begabtesten jüngeren Autoren Tschechiens - gab es Wellensittiche, die vor jedem politischen Umsturz verlässlich entflogen, und einen Vater, der sich depressiv in den Keller zurückzog, um an seinem eigenen Sarg zu schreinern. "Was kann ihm helfen?", fragt die Mutter den Arzt. "Eine erfolgreiche Konterrevolution", bekommt sie zur Antwort.
Die Tschechen sind seit jeher Meister darin, sich die triste Gegenwart vom Leibe zu halten, indem sie sie übertreiben und überzeichnen. Seit vielen Jahrzehnten halten sie mit bezaubernder Sturheit die altmodische Form des Schelmenromans hoch. Die kommunistische Diktatur hat diesen Umweg noch gefördert. Weil sie diese literarische Form noch immer mit Eleganz beherrschen, gelingt ihnen oft der Beweis, dass sich gerade aus der grotesken Überzeichnung neue Erkenntnis gewinnen lässt.
Das homerische Epos dieser Strömung hat nun Jirí Kratochvil geschrieben. Verwundert reibt man sich die Augen und denkt, auf dieses Buch muss vieles zurückgehen, was die tschechische Literatur seit langem ausmacht. Aber nein, das Buch stammt ja aus dem Jahr 1997. Der Titel allein hat bereits die nötige Opulenz: "Unsterbliche Geschichte oder Das Leben der Sonja Trotzkij-Sammler oder Karneval". Es ist die Lebensgeschichte einer Frau, der das Schicksal nicht nur ein außergewöhnlich langes Leben, sondern auch prophetische Einsicht in die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts verliehen hat. Zwar hat sie keine Eingriffsmöglichkeiten, aber sie steht quasi immer in der Nähe des unbekannten Regisseurs der Geschichte und sieht ihm auf die Finger.
In der Silvesternacht des Jahres 1899 auf 1900 wird sie in Brünn geboren, als Tochter eines Russen und einer Sudetendeutschen. Die Hebamme ist eine Ungarin aus Pressburg, die Mutter spricht deutsch und tschechisch auf das Neugeborene ein, der Vater kniet daneben und betet mit orthodoxer Inbrunst auf Russisch. So rasant, farbenprächtig und scheinbar ungezähmt entwickelt sich die Geschichte auch weiter: Nur vier Tage später stirbt in Wien aus Versehen der Mann, dem die kleine Sonja im Himmel vorbestimmt worden ist, der zu diesem Zeitpunkt zwölfjährige Bruno Mlock. Er bricht auf der zugefrorenen Donau ein und ertrinkt, und das Baby Sonja, das alles weiß und spürt, kann ihm nicht helfen, weit weg in Brünn und festgebunden in ihrem Wickelkissen. Sonjas ganzes langes Leben lang wird Brunos Seele ihr in immer neuen, tierischen Reinkarnationen wiederbegegnen, was zur Sodomie mit einem Affen, einem Hirsch und einem Elefanten führen wird. Der Wunsch, dass die beiden einander als Menschen wiedersehen können, geht nicht in Erfüllung. Als Fünfjährige wird sie an Bord eines Luftschiffes entführt, und dort pflanzen ihr die bedeutendsten Gelehrten des neunzehnten Jahrhunderts eine Nachricht an das 21. Jahrhundert ein. Deshalb muss Sonja weiterleben, beinahe so unsterblich wie ihre Geschichte.
Kratochvils Buch ist eine gewagte, doch geglückte Mischung aus wild wuchernder Phantasie, ironischer Übertreibung und geschichtlichen Begebenheiten des letzten Jahrhunderts. Das Leben der Sonja Trotzkij-Sammler ist darauf die irrwitzige Parabel, so voller grotesker Volten, Metaphern und Anspielungen, dass sich jede Nacherzählung von selbst verbietet. Von einer Audienz bei Masaryk über eine geplante Widerstandsaktion gegen die Nazis - die mittels trainierter russischer Werwölfe umgebracht werden sollen, die dann aber nicht zum Einsatz kommen und bloß Sonja schwängern, bevor sie erschossen werden -, bis hin zum Tod von Sonjas Eltern während der Vertreibung der Sudentendeutschen aus der Tschechoslowakei: Kratochvils verrückte Einfälle verspinnen sich suggestiv mit den Tragödien der Zeitgeschichte. Sein Buch ist unterhaltsam, beziehungsreich, und doch ist es eine Spur zu glatt. Es ist wie eine auf dem Reißbrett geplante Anarchie, ein literarisches und politisches Ratespiel, verquickt und verschnitten mit einem Metaphern-Handbuch und der abendländischen Mythologie, ein Heckenlabyrinth für eine literarische Schnitzeljagd.
Eine einzige Epoche gibt es übrigens, die Sonja nicht bewusst erlebt, die Kratochvil beziehungsvoll ausspart. Es ist die Paralyse des Kommunismus nach 1978. Sonja hat genug von einem Leben, in dem man sie bespitzelt und aus ihrer Wohnung vertreibt. Sie besteigt einen Turm und verspinnt sich dort in einem Kokon, für mehr als elf Jahre. Erst der Lärm der "Samtenen Revolution" weckt sie wieder auf. Vielleicht sollte ja Kratochvil, dessen erzählerisches und komisches Talent unbestreitbar ist, für gerade diese Zeitspanne eine angemessene literarische Form und damit etwas Neues finden.
EVA MENASSE.
Jirí Kratochvil: "Unsterbliche Geschichte". Roman. Aus dem Tschechischen übersetzt von Kathrin Liedke und Milka Vagadayová. Ammann Verlag, Zürich 2000. 298 S., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Jörg Plath zeigt sich zunächst ganz hingerissen von diesem allegorischen Schelmenroman, der durch das 20. Jahrhundert und die tschechische Geschichte führt. Typisch für diesen Roman sei, dass er die erzählerischen Perspektiven und Zeitebenen ständig wechselt und nicht Entwicklung, sondern Reihung zum Prinzip erhebt, wie Plath auch der dreimal ansetzende Titel verraten hat. Plath findet allerdings, dass Kratochvil mit seiner Vorliebe für sodomitische Spielereien allzu sehr aufs Derb-Erotische setzt und gegen Ende, im bleiernen Stalinismus angelangt, an Witz und Tempo verliert. Übrig bleibt beim Rezensenten nach einem fulminanten Geschichtenkarussell ein etwas schales Gefühl: so schön, so abstrus, so phantastisch dieser Roman teilweise erzählt ist, was hilft es, wenn er am Ende zu lang bzw gewaltsam und unstimmig zu Ende gebracht erscheint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH