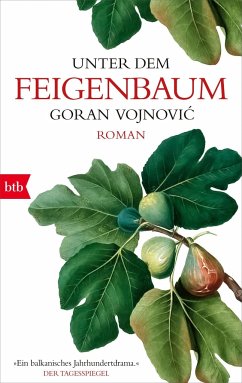»Ein balkanisches Jahrhundertdrama.« Der Tagesspiegel - Slowenien Ehrengast Frankfurter Buchmesse 2023
Über ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit Jadrans Großvater nach Istrien kam und dort eine Familie gründete. Nun ist er tot, und auch Jadrans Vater hat nach Ausbruch des Bosnienkrieges die Familie verlassen. Mit dem Besuch im Haus des Großvaters beginnt die Suche des jungen Mannes nach der eigenen Identität und führt ihn unweigerlich in die Wirren auf dem Balkan. Der Zerfall des Staates und dessen neue Grenzen haben auch die Familienbande zerschnitten. Einzig der Feigenbaum im Garten seines Großvaters scheint alle Stürme unbeschadet überstanden zu haben.
Über ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit Jadrans Großvater nach Istrien kam und dort eine Familie gründete. Nun ist er tot, und auch Jadrans Vater hat nach Ausbruch des Bosnienkrieges die Familie verlassen. Mit dem Besuch im Haus des Großvaters beginnt die Suche des jungen Mannes nach der eigenen Identität und führt ihn unweigerlich in die Wirren auf dem Balkan. Der Zerfall des Staates und dessen neue Grenzen haben auch die Familienbande zerschnitten. Einzig der Feigenbaum im Garten seines Großvaters scheint alle Stürme unbeschadet überstanden zu haben.

Zoltán Danyi und Goran Vojnovic blicken zurück auf die Jugoslawien-Kriege der Neunziger. Ihre Romane lassen befürchten, dass die Ereignisse noch lange nachwirken werden.
Von Tilman Spreckelsen
Safet Dizdar verschwindet am 4. März 1992. Der Serbe mit bosnischen Wurzeln lebt mit seiner Familie im slowenischen Ljubljana, was in den Zeiten Jugoslawiens eher unproblematisch ist. Als aber das Land zerfällt und statt der Zugehörigkeit zum Gesamtstaat nun viel wichtiger ist, ob einer Serbe, Kroate oder Slowene ist, befördert ihn die Polizei über die Grenze. Seine Frau Vesna und sein Sohn Jadran erfahren erst Tage später, dass er immerhin noch lebt, in der kleinen bosnischen Stadt, aus der Safets Vater stammt. Um dort zu kämpfen, wie die slowenische Polizei vermutet. Und als wenig später in der angespannten Ruhe von Safets Städtchen aus der Ferne Schüsse zu hören sind, denkt der aus Slowenien Vertriebene: "Es hat angefangen, endlich."
So jedenfalls reimt es sich sein Sohn Jadran zusammen, gut zwanzig Jahre später, als die Familie auf der Beerdigung seines Großvaters Aleksandar das erste Mal wieder zusammentrifft, als sein Vater plötzlich wiederauftaucht und die Ereignisse von damals wieder schmerzlich präsent werden. Weil sie, so schildert es der slowenische Autor und Regisseur Goran Vojnovic in seinem Roman "Unter dem Feigenbaum", immer weiterwirken, weil sich der Riss durch die Familie insgesamt auch in den einzelnen Familienmitgliedern fortsetzt und sich dem jungen Vater Jadran die Frage stellt, wie er seinen eigenen kleinen Sohn davor bewahren kann. Und weil daher, so erlebt es ein verstörter Veteran im Roman "Der Kadaverräumer" des ungarisch-serbischen Autors Zoltán Danyi ebenfalls Jahrzehnte nach dem Friedensschluss, "dieser beschissene Krieg niemals ein Ende nehmen wird".
Zwei Romane sind also in diesem Herbst auf Deutsch erschienen, die auf die Jugoslawien-Kriege der neunziger Jahre zurückblicken; die Originalausgaben stammen aus den Jahren 2015 und 2016. In beiden steht nicht das Kriegsgeschehen selbst im Vordergrund, sondern der Versuch, danach ein ziviles Leben wiederaufzunehmen, und die Frage, wie sich der Einzelne und wie sich die Gesellschaft der Vergangenheit stellen sollte. Dabei könnten die Voraussetzungen, unter denen erzählt wird, nicht unterschiedlicher sein, was vor allem der Herkunft und auch dem Alter der Protagonisten geschuldet ist: Vojnovics Roman nimmt die Perspektive eines jungen Slowenen ein, der wie sein Autor 1980 geboren wurde und der, wie er schreibt, zum ersten Mal einen Toten sieht, als 2012 sein Großvater stirbt - ein Erzähler in einem Umfeld also, das den Krieg glücklicherweise weniger zu spüren bekam als andere Regionen des ehemaligen Jugoslawiens.
Danyis titelgebender Kadaverräumer dagegen, auch er ungefähr im selben Alter wie sein 1972 geborener Autor, ist ein in der Vojvodina gebürtiger Mann, ein Angehöriger also der ungarischen Minderheit im serbischen Staat, der an den Kämpfen teilgenommen hat. Der Roman setzt mit einem Zittern ein, mit der Wahrnehmung des kurz zuvor nach Berlin gereisten Veteranen, dass die Erde um ihn bebt, und diese Unruhe wird ihn nicht mehr verlassen. In 74 hektischen Kapiteln auf 250 Seiten irrt er durch Serbien und Kroatien, er will in Berlin von Tempelhof nach Amerika fliegen, um dem exjugoslawischen Elend zu entkommen, und muss dann feststellen, dass der Flughafen seinen Betrieb eingestellt hat. Und er besucht in der Vojvodina eine Theateraufführung, die Erinnerungen in ihm wachruft, die er nur zu gern weiter verdrängt hätte: an die Zeit als Milizionär, in der er mit seiner Einheit in Dörfer einfiel und an Zivilisten Massaker verübte.
"Wir haben es getan, weil wir es konnten, und wenn es so geschah, dann musste es auch so geschehen, und wenn es so geschehen musste, dann kann keiner von uns etwas dafür, dass wir es getan haben." So kommentiert der Veteran diese auf ihn eindringende Erinnerung einmal, und es ist völlig unklar, von wem dieser ungeheuerliche Satz stammt - von einem Befehlshaber, einem Kameraden, ihm selbst? -, und ebenso, wann diese Parole ausgegeben wurde und ob der Veteran aus dem Abstand vieler Jahre noch daran glaubt, wenn er es denn je getan hat.
Jedenfalls reichen diese Worte nicht aus, um das innere Beben zu beschwichtigen, das sich auch im Körperlichen manifestiert (der Veteran berichtet ausführlich über die seit dem Krieg in Unordnung geratenen Funktionen seines Darms und seiner Blase) und ihn schließlich zu einem obskuren Heilpraktiker führt, der sich später als der untergetauchte Serbenführer Radovan Karadzic entpuppt - von dessen Verhaftung im Juli 2008 liest er dann in der Zeitung. Den Zustand Serbiens, das er mit einem "pleitegegangenen Unternehmen" und mit dem "Klo des Belgrader Busbahnhofs" vergleicht, malt er sich in den schwärzesten Farben, vor allem aber wird ihm immer klarer, dass die Zeit des aggressiven serbischen Nationalismus, "jene alles verwüstenden, alles ausbeinenden Jahre noch nicht zu Ende waren, und sie würden vermutlich auch nie mehr zu Ende gehen, zumindest was ihn anbelangte, mit Sicherheit nie". Er jedenfalls läuft durch die zivile Gegenwart und trägt wüste Tötungsphantasien mit sich herum.
Luft macht sich der Einzelgänger in gespenstischem Gerede, das niemand hört, den es angeht - sein Pfleger in einem deutschen Krankenhaus verlässt währenddessen einfach das Zimmer, ein Clochard auf einer Parkbank verschläft die Erzählung des derangierten Serben, und die Eiswürfel in seinem Cocktailglas erweisen sich noch als die respektvollsten Zuhörer seiner Suada von den begangenen Kriegsverbrechen. Als er dann versucht, das Geschehen aufzuschreiben, kommt er nur zu wenigen Sätzen in den eigens dafür gekauften Heften, die er anschließend in den Müll wirft.
Der andrängenden Erinnerung und der Einordnung des Geschehens kann er sich trotzdem nicht entziehen. Kaum zufällig arbeitet er an einem Großmosaik im Haus eines reichen Kriegsgewinnlers; auch später dienen explizit die Mosaikteile als Metapher für seine Bewältigungsarbeit. Dem Kern des Ganzen nähert er sich sprunghaft, die variierende Wiederholung des Gesagten erweist sich als wirkungsvolles Stilmittel für diese quälende Suche, die schließlich in der Deutung seiner Nachkriegsarbeit als "Kadaverräumer" zur Beseitigung von Tierleichen mündet: Seine Gruppe sei aus einer Einheit hervorgegangen, die zuvor Kriegsverbrechen vertuscht hatte.
Diese Bewegung, die sich durch mehrere Schichten der Vergangenheit arbeitet, um zu einer Wahrheit vorzustoßen, die das fragile Selbstverständnis und die Identität des Suchenden betrifft, liegt auch der Familiengeschichte zugrunde, die Jadran, der Slowene mit bosnischserbisch-kroatischen Wurzeln, im Roman "Unter dem Feigenbaum" erzählt. Dass er dabei notgedrungen spekuliert, legt er selbst offen, wenn er etwa detailliert von der Ankunft seines Vaters in jenem bosnischen Städtchen erzählt, obwohl er doch, wie er einräumt, weder Zeuge davon war, noch sein Vater je davon erzählt hatte. Ähnlich verhält es sich mit der spannungsreichen Liebesgeschichte der Großeltern oder einem einjährigen Kairo-Aufenthalt des Großvaters, und auch über die wechselseitig zugefügten Verletzungen innerhalb der Familie gibt es nur Vermutungen, die im Verlauf der Handlung an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Die vier bis fünf Generationen, die Jadran dabei in den Blick nimmt, vertreten auch unterschiedliche Teilrepubliken des jugoslawischen Staats, und die Konflikte spiegeln sich in den Sticheleien der Familienmitglieder untereinander, die bisweilen explizite Stereotypen, die an die Ethnien geknüpft sind, zum Inhalt haben - was um so heftiger wird, je manifester die Spannungen zwischen den Teilrepubliken auf der politischen Ebene werden.
Was das bedeutet, erfährt Jadran, als er als Sechzehnjähriger ins Bosnien der Nachkriegszeit fährt und seinen Vater kaum mehr wiedererkennt. Tatsächlich sind die Verstörungen über diejenigen, die einem eigentlich am nächsten sind, ein großes Thema dieses Romans, und auch die Erschütterungen über die Zeitläufte, die das begünstigen: "Als hätte jemand eine Grenze mitten durch mich hindurchgezogen."
Beiden Romanen gemein ist die verschlungene, hakenschlagende Chronologie. Struktur verleiht ihnen jeweils nicht eine geradlinig erzählte Handlung, sondern im Gegenteil der Versuch, aus der Rückschau ein Geheimnis aufzudecken, das von Anfang an da gewesen ist und das ebenso gut außerhalb wie innerhalb des jeweiligen Protagonisten liegt. Und während in Vojnovics Roman die Familie alles ist, im Guten wie im Schlechten, stolpern in Danyis Buch die Protagonisten allein durch die Welt, von Eltern oder gar Kindern ist so gut wie nicht die Rede.
Vor allem aber beschreiben diese beiden so unterschiedlichen Romane, welch ein Unglück für viele Protagonisten der Zerfall Jugoslawiens bedeutet. "Ich will nur meinen eigenen Staat", sagt Jadrans Onkel Dane, der Slowene, zu seinem Schwager. Der fragt zurück: "Und deshalb fährst du meinen an die Wand?" Dass ihr Schicksal untrennbar an den Zustand Jugoslawiens geknüpft ist, wissen beide.
Zoltán Danyi: "Der Kadaverräumer". Roman.
Aus dem Ungarischen von Terézia Mora. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 251 S., geb., 24,- [Euro].
Goran Vojnovic: "Unter dem Feigenbaum". Roman.
Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Folio Verlag, Wien 2018. 352 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Jörg Plath lobt Goran Vojnovics neuen Roman "Unter dem Feigenbaum" als lesenswertes "Sittenbild der postjugoslawischen Gesellschaften". Wie ihm der slowenische Autor und Filmregisseur hier anhand von drei Generation bildgewaltig von Trennungen, Verlust und dem Zerbrechen einer Familie erzählt, hat dem Kritiker gut gefallen. Auch damit, dass Vojnovic fragmentarisch und in "aufgelöster Chronologie" schreibt, kommt Plath gut zurecht. Dass der Autor in seinem melancholisch grundierten Roman gelegentlich zu "Pathos" neigt, kann der Rezensent verzeihen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH