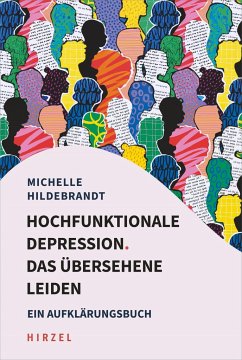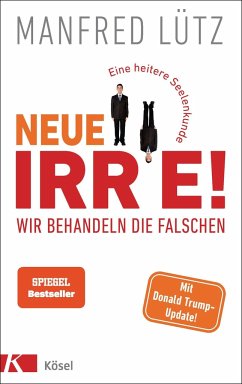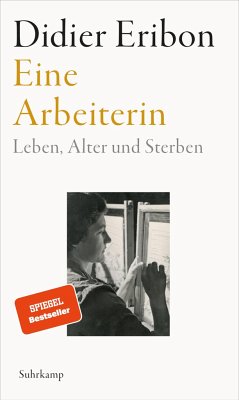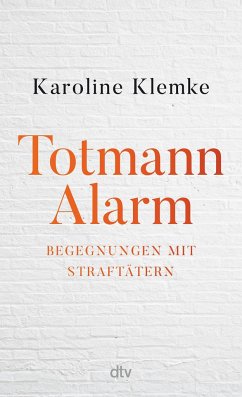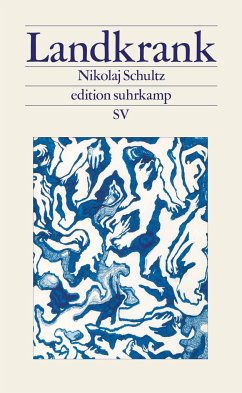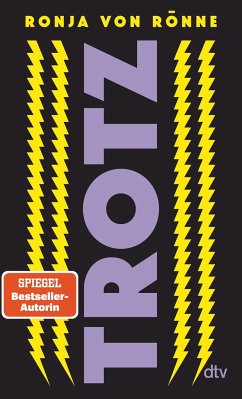Unter Verrückten sagt man du
Eine dringend notwendige Psychiatrie- und Gesellschaftskritik

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Dieses klare und schöne Buch zeigt: Ohne das Verrücktsein wäre unsere Welt ein schlechterer Ort.« Julia von HeinzAn einer Umbruchstelle im Leben wird Lea De Gregorio verrückt. Zu viele Gedanken drehen frei in ihrem Kopf, zu viele Fragen rasen ihr durchs Herz, der Schlaf bleibt aus. Und es folgt, was hierzulande nun mal vorgesehen ist: die Behandlung in der Psychiatrie. Doch geht der Heilung die Entmündigung voraus. Hier bestimmen, entscheiden, sprechen andere für sie. Muss sie sich dieser althergebrachten Ordnung tatsächlich fügen, damit alles besser wird? Oder sie erst recht in Fra...
»Dieses klare und schöne Buch zeigt: Ohne das Verrücktsein wäre unsere Welt ein schlechterer Ort.« Julia von Heinz
An einer Umbruchstelle im Leben wird Lea De Gregorio verrückt. Zu viele Gedanken drehen frei in ihrem Kopf, zu viele Fragen rasen ihr durchs Herz, der Schlaf bleibt aus. Und es folgt, was hierzulande nun mal vorgesehen ist: die Behandlung in der Psychiatrie. Doch geht der Heilung die Entmündigung voraus. Hier bestimmen, entscheiden, sprechen andere für sie. Muss sie sich dieser althergebrachten Ordnung tatsächlich fügen, damit alles besser wird? Oder sie erst recht in Frage stellen? Eine Suche nach grundlegenden Antworten beginnt, sie führt sie an tabuisierte Orte der Geschichte, in unsere Sprache, die Philosophie und schließlich in den Kampf. Gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Verrückten, einer viel zu lange übersehenen Minderheit.
Lea De Gregorio entlarvt die tradierten Ungerechtigkeiten in unserem Denken, Fühlen, Handeln. Unter Verrückten sagt man du leistet dringend notwendige Psychiatrie- und Gesellschaftskritik. In einer Sprache, die so klar und so klug und so zärtlich ist, dass sie den Blick auf unser Zusammenleben substanziell zu verändern vermag.
An einer Umbruchstelle im Leben wird Lea De Gregorio verrückt. Zu viele Gedanken drehen frei in ihrem Kopf, zu viele Fragen rasen ihr durchs Herz, der Schlaf bleibt aus. Und es folgt, was hierzulande nun mal vorgesehen ist: die Behandlung in der Psychiatrie. Doch geht der Heilung die Entmündigung voraus. Hier bestimmen, entscheiden, sprechen andere für sie. Muss sie sich dieser althergebrachten Ordnung tatsächlich fügen, damit alles besser wird? Oder sie erst recht in Frage stellen? Eine Suche nach grundlegenden Antworten beginnt, sie führt sie an tabuisierte Orte der Geschichte, in unsere Sprache, die Philosophie und schließlich in den Kampf. Gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Verrückten, einer viel zu lange übersehenen Minderheit.
Lea De Gregorio entlarvt die tradierten Ungerechtigkeiten in unserem Denken, Fühlen, Handeln. Unter Verrückten sagt man du leistet dringend notwendige Psychiatrie- und Gesellschaftskritik. In einer Sprache, die so klar und so klug und so zärtlich ist, dass sie den Blick auf unser Zusammenleben substanziell zu verändern vermag.