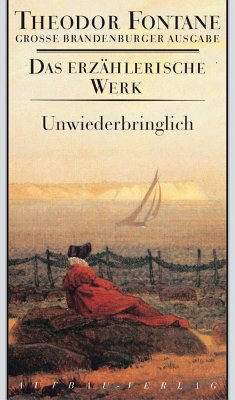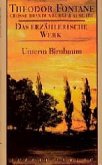Neben »Effi Briest« und dem »Stechlin« liegt jetzt auch Fontanes drittes Meisterwerk, der Ehe- und Ehebruchsroman »Unwiederbringlich«, in der Großen Brandenburger Ausgabe vor - ein Ereignis für alle Fontane-Enthusiasten und Kenner seines Schaffens. Hervorragende Textpräsentation nach der Erstauflage, vorzügliche Kommentierung und eine selten gewordene buchkünstlerische Gestaltung kennzeichnen diese wegweisende Edition. Sie vermittelt zwischen den Lesebedürfnissen eines breiten Publikums und den wissenschaftlichen Interessen der Experten.Graf Holk hat ein gutes, aber schwaches Herz. Er hat sich eingerichtet in dem schönen Schloß am Meer, die Ehe mit Christine ist das Fundament seines Lebens, auch wenn Differenzen in bezug auf die Religion und die Erziehung der Kinder ihn zunehmend seiner Frau entfremden. Im Herbst begibt er sich wie jedes Jahr nach Kopenhagen, um bei der Prinzessin seinen Dienst als Kammerherr anzutreten. Der Wunsch, alles Unbehagen abzustreifen, läßt ihn das gewohnte Quartier bei der Witwe Hansen in einem zauberischen Licht erscheinen. Alles ist auf Verführung gestellt, deren Inbegriff die geistreich-pikante Ebba von Rosenberg ist. Die Grenzen scheinen aufgehoben, jeder Ort ist eine Lockung und jede Zeit eine Ewigkeit. Holk verliert den Boden unter den Füßen und erliegt einer Verblendung, die nicht größer sein könnte als der Brand des Schlosses in ebendieser Nacht. Als er sein Abenteuer dingfest machen und Ebba heiraten will, reißt der Wahn, und er steht vor den Trümmern seiner Existenz.Herausgegeben von Christine Hehle

Aus Anlaß der Neuausgabe von Theodor Fontanes spätem und erstaunlichem Roman "Unwiederbringlich"
In Thomas Manns Prosa werden wir hier und da vorsichtig auf bevorstehende Pointen vorbereitet. Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, der Autor wolle den Lesern bedeuten: Achtung, jetzt kommt etwas Besonderes. Es kommt auch tatsächlich. Beglückt genießen wir es - einschließlich der in dieser herrlichen Epik bisweilen nur winzigen und doch nicht zu übersehenden Beimischung von Koketterie. Wir lieben das augurenhafte Lächeln des großen Zaubermeisters, der uns sagen möchte: Seht her, was für einer ich bin. Er zwingt uns stets aufs neue, zu ihm, zu seiner in der Geschichte der deutschen Prosa nie vor ihm und nie nach ihm gekannten Virtuosität höchst dankbar aufzublicken.
Für Fontane gilt das nicht. Sicherlich, auch er möchte den Leser beeindrucken. Insgeheim will auch er, wie jeder Erzähler, uns imponieren. Doch letztlich ist ihm der Gestus Thomas Manns fremd - der Gestus des, wenn man so sagen darf, vornehmen Auftrumpfens. Nicht daß es in Fontanes Romanen an Bravourstücken mangelte, nur könnte man oft glauben, er habe es auf sie gar nicht abgesehen. Bei ihm naht das Bravouröse auf leisen Sohlen und wird erstaunlich schwerelos vorgebracht.
Das Besinnliche ist seine Sache und das Beschauliche, das aber nie in die Nähe des Betulichen gerät. Er erzählt entspannt, locker und souverän. Theodor Fontane ist kein Virtuose, es ist ihm daran auch offensichtlich nicht gelegen.
Er zwingt uns nicht in die Knie. Er ist eher ein Plauderer, freilich nicht nur ein gemütlicher, sondern auch ein begnadeter. Nicht der effektvolle artistische Auftritt ist also seine Sache, sondern die Arabeske. Er ist, wenn nicht der Erfinder, so mit Sicherheit der Meister der beiläufigen Pointe. Es gibt bei ihm auch schwache Seiten - wie könnte es anders sein? -, aber die Prosa des Romanciers Fontane bleibt frei von kalter Perfektion und sprachlicher Routine. Er verheimlicht nicht, daß gerade der saloppe Ton ihm Spaß und Freude bereitet. Er schreibt einen so unangestrengten Stil, daß man auf die Idee kommen könnte, er strenge sich nicht an - was, versteht sich, Unsinn wäre. Ob es uns gefällt oder nicht: Zu Fontane brauchen wir nicht aufzublicken.
Warum? Weil er, um sein Lieblingswort zu verwenden, ein so "kolossaler" Literat wie der Autor des "Zauberbergs" und der "Joseph"-Tetralogie nun doch nicht war? Es ist wohl etwas anderes: Auch in seinen bedeutendsten Romanen redet er zu uns - das oft mißbrauchte Wort ist nicht vermeidbar - immer in Augenhöhe. So entsteht bei der Lektüre seiner Romane ein schönes und in der Geschichte der deutschen Literatur ungewöhnliches Vertrauensverhältnis - des Romanciers mit seinem Publikum. Es entsteht wie von selbst, das soll heißen: Ohne daß sich Fontane je bemüht hätte, seinen Lesern besonders entgegenzukommen oder sich gar bei ihnen anzubiedern. Aber sie werden auch nicht überfordert.
Ein Plauderer also. Und doch ein Klassiker? Man hätte diese Frage um 1900, kurz nach seinem Tod, gewiß eher verneint. Die erste Ausgabe seiner "Gesammelten Werke", die zwischen 1905 und 1910 in einundzwanzig Bänden erschienen ist, hat daran nicht viel zu ändern vermocht - obwohl es doch in Deutschland gerade derartige verlegerische Unternehmen sind, die einen Autor in den Klassikerrang befördern.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist Fontane allmählich in Vergessenheit und beinahe in Verruf geraten. Hierzu haben nicht nur die Universitätsgermanisten beigetragen, die von ihm nichts wissen wollten, sondern auch Schriftsteller wie etwa Döblin und Tucholsky: Sie haben sich über ihn hochmütig geäußert und ihn kurzerhand für überlebt erklärt. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Fontane von Benn als "pläsierlich" denunziert. Das meinte wohl auch mein Deutschlehrer an einem Berliner Gymnasium, der, als ich 1938 für die mündliche Abiturprüfung das Thema "Fontanes späte Romane" vorschlug, es gleich ablehnte und nicht mit sich reden ließ - er hielt ihn für einen nicht unbekannten, doch letztlich mehr oder weniger unseriösen Autor. Gegen die Dramen des jungen Hauptmann als Abiturthema hatte er nichts einzuwenden. Der wichtigste Grund: Romanciers hatten es bei den Germanisten alten Stils immer schon ungleich schwerer als Dramatiker oder Lyriker - es sei denn, es handelte sich um einen Weltbestseller. Aber da gab es nur einen, den "Werther".
In unseren Tagen sprechen die meisten professionellen Germanisten über Fontane durchaus respektvoll. Indes hat dies der Beziehung des Publikums zu seinem Werk nicht geschadet: Nach wie vor schüchtert er niemanden ein. Er wird heute wie kein anderer deutscher Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts nicht nur gerühmt, sondern auch tatsächlich gelesen. Seine Romane werden ähnlich wie zu seinen Lebzeiten als schöne, doch nicht übermäßig anspruchsvolle Belletristik konsumiert. Etwas übertreibend könnte man sagen, mittlerweile mache Fontane süchtig, beinahe. So hat er jetzt eine treue und noch wachsende Gemeinde. Er ist ein Unterhaltungsschriftsteller geblieben und ein Klassiker geworden. Welch ein ungewöhnlicher Triumph für einen Autor, dem man einst das Leichte verübelt, das Anmutige vorgeworfen und das Charmante verargt hat!
Nur liest man ihn jetzt anders als vor fünfzig oder gar hundert Jahren. Fontane hat sich mit der wilhelminischen Gesellschaftsordnung zwar abgefunden (was blieb ihm anderes übrig?), ohne sie jedoch in Wirklichkeit zu akzeptieren. Er hat, ähnlich wie Ibsen, die Lebenslüge und die Moral, besser: die Scheinmoral dieser Gesellschaft durchschaut und immer wieder angeklagt. Er hätte schon gern Idyllen geschrieben, aber er mußte Anti-Idyllen schreiben. Sein Spätwerk lebt von der Spannung zwischen der Sehnsucht nach Verklärung und der Notwendigkeit der Desillusionierung.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: So wichtig und verdienstvoll die Gesellschaftskritik in Fontanes Werk auch ist, so läßt sie uns heute kalt. Sie geht uns nichts mehr an, sie ist nur noch der Schnee von gestern. Denn sie betrifft eine Welt, die nicht mehr die unsere ist. Daß der ganze Komplex der Beziehung zwischen den Geschlechtern im neunzehnten Jahrhundert, alles, was mit Ehe, Liebe und Sexualität zusammenhängt und was ja bei Fontane meist im Mittelpunkt steht, mit den Verhältnissen im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht im entferntesten verglichen werden kann, ist eine Binsenweisheit. Geändert haben sich die moralischen Vorstellungen und die juristischen Gegebenheiten, die konkreten Umstände, die Kostüme und die Requisiten. Nicht geändert aber haben sich - im großen und ganzen natürlich - die Leiden der Menschen. Sie, nur sie sind zeitlos.
Am wenigsten wurden bei Fontane die psychologischen Elemente vom Zahn der Zeit angegriffen, zumal die oft verblüffenden Nuancen. Was immer sich gewandelt hat: Das Erotische ist im Grunde nicht verblaßt. Dies aber haben wir in seiner Epik nicht unbedingt dem Gang der äußeren Ereignisse zu verdanken, nicht den übergreifenden Handlungslinien. In seinen späten Romanen hat er die Fabel auf ein Minimum beschränkt. Er selber spottete über den "Stechlin": "Zum Schluß stirbt ein Alter, und zwei Junge heiraten sich; - das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht". Seine "Poggenpuhls" seien - schrieb er in einem Brief - kein Roman, und man bekomme keinen Inhalt geboten: "Das ,Wie' muß für das ,Was' eintreten."
Obwohl diese Selbstcharakteristik Fontanes auf seine letzten Werke gemünzt war, können wir sie auf alle seine Romane beziehen. Schon wahr: Es ist nicht gleichgültig, wer in ihnen wen liebt, verführt, schwängert, heiratet, betrügt oder tötet. Aber ihre kaum nachlassende Qualität bewirken die Einzelheiten, das "Wie". Konsequent vom Alltäglichen ausgehend, wandte er seine Aufmerksamkeit immer wieder den Details zu, den geringfügigen Begebenheiten, dem scheinbar Belanglosen, den Nuancen. Er liebte jene "Kleinigkeiten, die meist die Hauptsache sind". Das läßt er die Gräfin Christine sagen, eine der Hauptfiguren seines 1890 abgeschlossenen Romans "Unwiederbringlich".
Was sich hier abspielt, kann man mit wenigen Worten andeuten. Es ist die Geschichte einer Ehe - also, wie man sich denken kann, eine traurige Angelegenheit. In der Regel ist es ja nur der Ehebruch, der dieses Thema für einen Roman interessant machen kann. Stets läuft das Ganze auf eine Katastrophe zu, die so gut wie immer ihre Ursache in der unterschiedlichen Mentalität der Ehepartner hat. So ist es auch in "Unwiederbringlich".
Allerdings gibt sich Fontane mit den Porträts dieser Ehepartner nicht zu viel Mühe. Er teilt uns einfach mit, daß Graf Holk, ein Mann Mitte Vierzig, brav und lebensfroh sei, doch auch schwach und eitel. Seine Intelligenz hält sich in bescheidenen Grenzen, was ich sehr bedauere: Unintelligente Romanhelden sind nicht nur für ihre Gattinnen wenig anregend, sondern auch für uns Leser. Christine wiederum, mit der Holk seit siebzehn Jahren verheiratet ist und zwei Kinder hat, wird ohne viel Umstände als puritanisch, pietistisch, prüde und pathetisch vorgestellt: "Immer Harmonium, immer Kirchenleuchter, immer Altardecke mit Kreuz. Es ist nicht auszuhalten." Überdies sei sie ihrem Mann geistig überlegen, was wir allerdings aufs Wort glauben müssen.
Da sitzt schon der Wurm. Denn Fontane gehört zu jenen Romanciers, die ihre Geschöpfe nicht lieben können, ohne sie zu kritisieren, und die - darauf kommt es hier an - nur jene zu kritisieren Lust haben, die sie auch wirklich lieben. Daher sind seine besten Figuren nie frei von inneren Widersprüchen - und ebendas macht sie reizvoll und interessant: für den Autor und für das Publikum. Aber Holk und seine Frau sind ziemlich eintönig und leider durchaus nicht widerspruchsvoll.
Daß "Unwiederbringlich" dennoch ein hoch beachtlicher Roman geworden und geblieben ist, hat gute Gründe. Zunächst: Die Ehepartner langweilen sich miteinander, mehr noch: Alle langweilen sich hier - nur nicht die Leser. Es wimmelt in diesem Buch von Lebenskritik und Lebensweisheit, von schönen Formulierungen und klugen Beobachtungen - und es stört uns nicht sonderlich, daß man sie mitunter von Personen zu hören bekommt, denen man derartige Äußerungen nicht zutrauen kann. Sie sind es, die die Lektüre auch dieses Fontane-Romans zu einem wahren Vergnügen machen. Ferner tritt in ihm eine der originellsten Figuren auf, die es in seiner Epik gibt: ein Hoffräulein, das den Weg des Grafen Holk in Kopenhagen kreuzt. Sie ist jüdischer Herkunft.
Fontane und die Juden - das ist ein heikles, ein gefährliches Thema. Wieso gefährlich? Weil es in seinen Romanen ebenso wie in den vielen Briefen, für die ich eine besondere Schwäche habe, Hunderte von Bemerkungen gibt, mit denen sich beweisen läßt, was man gerade beweisen will: einerseits, daß Fontane zu den schlimmen Antisemiten gehörte, und andererseits, daß er keineswegs gegen die Juden war, daß er sogar viel Sympathien für sie hatte, sie schätzte und bisweilen bewunderte.
Ich habe nicht die Absicht, dieses beliebte Spiel hier fortzusetzen. Zusammenfassend kann man nur sagen: Die Juden haben Fontane interessiert und zugleich irritiert, beides in hohem Maße. Gern rühmte er ihre Leistungen im Berliner Kulturleben, ohne sich mit ihrer wachsenden Rolle in Preußen abfinden zu wollen. In seiner (nie für die Veröffentlichung bestimmten) Korrespondenz fallen uns auch wütende, zornige Worte gegen Juden auf. Natürlich ist es möglich, daß sie aus seiner Feder in Augenblicken geflossen sind, in denen die Selbstkontrolle des in der Regel eiligen und temperamentvollen Briefschreibers eingeschränkt war.
Jedenfalls darf man nicht übersehen, daß die nicht wenigen jüdischen Gestalten in Fontanes Romanen (meist Nebenfiguren), anders als etwa die düsteren Protagonisten in Wilhelm Raabes "Hungerpastor" oder in Gustav Freytags "Soll und Haben", niemals gehässig gezeichnet sind. Freilich ist Fontanes Verhältnis zu ihnen stets ambivalent. Auch wenn er die Juden wohlwollend darstellt, hat er meist doch kein Vertrauen zu ihnen. Er empfindet sie als fremd und etwas unheimlich.
Mit dieser Vokabel - "unheimlich" - wird auch Ebba von Rosenberg bedacht, das Hoffräulein in "Unwiederbringlich". Sie ist eine Enkeltochter des "Lieblings- und Leibjuden" König Gustav III. von Schweden. Ihre Familie stammt aus Polen, sie selber, in Paris geboren, längst assimiliert und getauft, darf nun am dänischen Hof reüssieren. So jung sie auch ist, so hat sie schon, wie uns angedeutet wird, eine Vergangenheit. "Das öde Einerlei" des Hoflebens behagt ihr nicht.
Die reizvolle und verführerische, die beinahe immer schwarzhaarige Jüdin gehört zum Personal der deutschen Literatur in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, so bei Freytag, bei Felix Dahn und nicht selten im Unterhaltungsroman. Es entsteht ein neuer Begriff und rasch ein neues Klischee: "die schöne Jüdin". Übrigens auch in anderen Literaturen, so in der polnischen. Um dieses Klischee zu vermeiden, hat Fontane seiner Jüdin andere Züge gegeben; sie ist blond und eben nicht ein Ausbund von Schönheit. Wohl aber ist diese Ebba eine ungewöhnlich intelligente Lebenskünstlerin, keck und - das Wort kommt mehrfach vor - "übermütig". In ihrem Blick wird "ein leiser Anflug von Spott und Überlegenheit" wahrgenommen. Daß sie viel Temperament hat, versteht sich von selbst. Man sagt ihr Eloquenz und "Sufficance" nach, sie sei "moquant und "pikant" und obendrein auch noch romantisch.
Was ist denn mit dem Wort "pikant" gemeint? Etwa ein wenig exotisch? Oder zielt Fontane gar auf das Frivole ab? Dies ist sicher: Inmitten des dänischen Hofmilieus wirkt Ebba provozierend - und ebendeshalb wird sie von den Damen so mißtrauisch beobachtet, wie sie für die Herren rasch attraktiv ist. Niemand beanstandet ihre jüdische Herkunft, aber niemand kann sie vergessen. Was Ebba tut und sagt, wird oft auf ihre Abstammung zurückgeführt. Warum wird sie am Hof beschäftigt oder zumindest freundlich geduldet? Ganz einfach: Sie ist gescheit und geistreich und in dieser Hinsicht den Frauen weit und breit überlegen. Sie ist, was es damals in ganz Europa doch nur selten gab: eine Person weiblichen Geschlechts und zugleich eine Intellektuelle. Sie repräsentiert den Freigeist, die Aufklärung. Sie gefällt sich darin - das wirft man Juden gern vor -, alles auf die Spitze zu treiben. Sie wird gebraucht, beliebt ist sie nicht.
Sie wird auch von Fontane dringend benötigt: Keine andere Figur in diesem Roman läßt er seine Ansichten, zumal die Erotik betreffend, so direkt und nachdrücklich aussprechen wie ebendas Hoffräulein jüdischer Herkunft. So erklärt sie überraschend dem Grafen Holk, man müsse, will man Menschen beurteilen, erst einmal fragen, wie sie sich zu Liebesverhältnissen stellen, und antwortet ganz ungeniert: "Was wäre das Leben ohne Liebesverhältnisse? Versumpft, öde, langweilig. Aber verständnis- und liebevoll beobachten, wie sich aus den flüchtigsten Begegnungen und Blicken etwas aufbaut, was dann stärker ist als der Tod, - oh, es gibt nur eines, das noch schöner ist, als es zu beobachten, und das ist, es zu durchleben."
Die bejahrte Prinzessin sieht sofort, was sich da anbahnt und bittet Ebba, den Grafen in Ruhe zu lassen und sich lieber, wenn es denn sein muß, einen Seitensprung, eine "Eskapade" mit einem ihrer Kammerherrn zu gönnen. Die Bitte sei, antwortet Ebba, an die falsche Adresse gerichtet: "Er ist seiner Frau Treue schuldig, nicht ich, und wenn er diese nicht hält, so kommt es auf ihn und nicht auf mich."
Natürlich, er landet in ihrem Bett. Was sich dort abspielt, schildert Fontane nicht. Und wozu sollte er es tun? Auf die kurze, weil plötzlich unterbrochene Episode reagieren die beiden unterschiedlich. Alles geht jetzt holterdiepolter: Der Graf eilt zu seiner Frau, beichtet und bittet um die Scheidung, in die sie sofort einwilligt. Er ist frei, er wird Ebba heiraten - meint er. Aber sie denkt nicht daran: "Wie kann man sich einer Dame gegenüber auf Worte berufen, die die Dame töricht oder vielleicht auch liebenswürdig genug war, in einer unbewachten Stunde zu sprechen? Es fehlt nur noch, daß sie sich auch auf Geschehnisse berufen, und der Cavalier ist fertig." In der Liebe reagiere der Augenblick, wer daraus Rechte herleiten wolle, der sei - sagt Ebba - "kein Held der Liebe, der ist bloß ihr Don Quixote". Sie ist aus Langeweile mit Holk ins Bett gegangen, vielleicht ein wenig aus Neugierde. Es war für sie ganz nett und nicht sehr wichtig. Er aber wolle "aus einem bloßen Spiel einen bitteren Ernst machen".
Was sonst in dem Roman passiert - und es ist mit einem Schloßbrand, einem nicht glaubwürdigen oder jedenfalls nicht überzeugenden Selbstmord und anderen dramatischen Effekten eine ganze Menge -, braucht hier nicht erwähnt zu werden. Nur soviel: Diese Ebba gefällt mir außerordentlich. Mit den vielen jungen Damen in Fontanes Welt verglichen, ist sie reifer und klüger und, vor allem, selbständiger, sie ist eine emanzipierte Frau. Sie ist mit Sicherheit die in dem Roman "Unwiederbringlich" modernste Gestalt. Gemeinsam verweisen sie auf die Zukunft, auf das zwanzigste Jahrhundert: Theodor Fontane und seine Ebba von Rosenberg.
Den Roman, der keine dreihundert Seiten umfaßt, hat die Herausgeberin Christine Hehle mit einem soliden und ausführlichen, einem bisweilen schon üppigen Anhang von über zweihundert Seiten versehen. Wird Christine einmal mit der heiligen Elisabeth verglichen - und schon informiert uns die Editorin über alle Heiligen dieses Namens; als sich Graf Holk in London aufhielt, sah er vier Stücke von Shakespeare. Die beiläufige Mitteilung wird uns gründlich kommentiert: Die Editorin erzählt uns den Inhalt dieser nicht eben unbekannten Stücke ("Sommernachtstraum", "Sturm", "Wintermärchen" und "Heinrich VIII."). Ich fürchte, daß sich derartige Anmerkungen einer Selbstparodie unserer Philologie nähern.
Theodor Fontane: "Unwiederbringlich". Roman. Herausgegeben von Christine Hehle. Aufbau-Verlag, Berlin 2003. 514 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als "hochbeachtlichen Roman" feiert Marcel Reich-Ranicki Theodor Fontanes 1890 abgeschlosssene Geschichte einer Ehe. Den gräflichen Ehemann Holk findet er zwar langweilig. Überhaupt würden sich im Roman alle miteinander langweilen, nur eben die Leser nicht. Reich-Ranicki sieht es in diesem Buch von Lebenskritik und Lebensweisheit wimmeln, von schönen Formulierungen und Beobachtungen. Zu einem wahren Vergnügen wird die Lektüre für ihn besonders dann, wenn er diese Weisheiten von Personen des Romans zu hören bekommt, denen er sie gar nicht zugetraut hätte. Auch ist er darin einer der originellsten Figuren begegnet, die Fontanes Epik aus seiner Sicht überhaupt zu bieten hat. Jene Ebba von Rosenberg sei jüdischer Herkunft und für Reich-Ranicki ist sie deshalb so wichtig, weil Fontane sie gegen das damals herrschende literarische Klischee von schönen Jüdin gestaltet hat. Gleichzeitig präsentiert sie für ihn "den Freigeist, die Aufklärung". Keine andere Figur des Romans lasse Fontane ihre Ansichten ("zumal die Erotik betreffend") so direkt und nachdrücklich aussprechen wie dieses Hoffräulein jüdischer Herkunft, die der Rezensent als "die modernste Gestalt" des Roman empfunden hat. Das Nachwort der Herausgeberin beurteilt er als solide und ausführlich. Bescheinigt wird der Editorin wegen ihrer gelegentlich als übertrieben empfundenen Gründlichkeit jedoch auch eine Tendenz zur "Selbstparodie unserer Philologie".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Auch gut hundert Jahre nach seinem Ersterscheinen hat das Werk nichts von seinem Reiz verloren. Dieser liegt vor allem in der meisterhaften Beherrschung der Sprache. Die vorliegende Edition besticht nicht nur durch die ausführliche Kommentierung, sondern bezieht ihren Charme auch aus dem Schriftbild.« Frankfurter Neue Presse 20040122