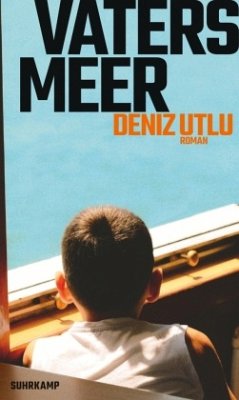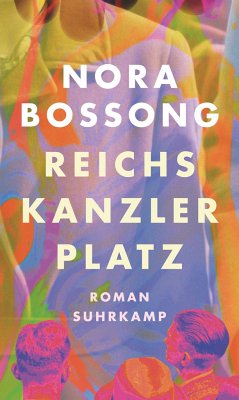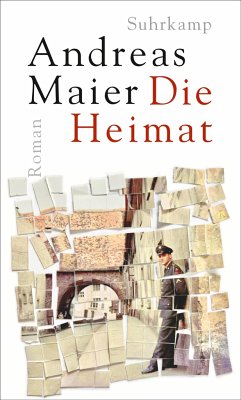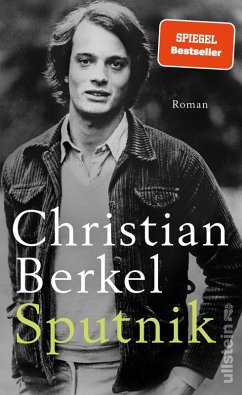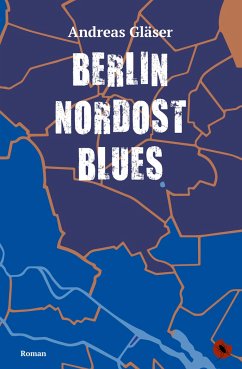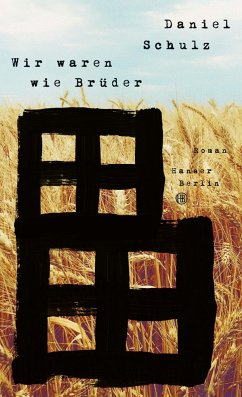Väter
Roman Vom Vaterhaben und Vatersein

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Erst als der Sohn ihn danach fragt, spricht der Vater, Jahrgang 1933, von der NS-Zeit. Von der Napola, der Nationalpolitischen Lehranstalt, vom jüdischen Fellhändler am Markt und von seinem Onkel. Jenem Onkel Paul, nach dem der Sohn benannt ist und der NSDAP-Kreisgeschäftsführer war. Im Bundesarchiv findet der Sohn, als jüngstes von acht Kindern 1980 geboren, nur eine schmale Akte. Doch ihn lassen die Fragen nicht los: Wie setzen sich nationalsozialistische Prägungen auch in seiner Familie fort? Welche überkommenen Ideale, welche patriarchalen Vorstellungen haben sich in ihn eingeschrie...
Erst als der Sohn ihn danach fragt, spricht der Vater, Jahrgang 1933, von der NS-Zeit. Von der Napola, der Nationalpolitischen Lehranstalt, vom jüdischen Fellhändler am Markt und von seinem Onkel. Jenem Onkel Paul, nach dem der Sohn benannt ist und der NSDAP-Kreisgeschäftsführer war. Im Bundesarchiv findet der Sohn, als jüngstes von acht Kindern 1980 geboren, nur eine schmale Akte. Doch ihn lassen die Fragen nicht los: Wie setzen sich nationalsozialistische Prägungen auch in seiner Familie fort? Welche überkommenen Ideale, welche patriarchalen Vorstellungen haben sich in ihn eingeschrieben und gibt er vielleicht selbst weiter? In welchen Konflikten treten sie bis heute zutage? Er stellt fest, wie herausfordernd es ist, im Umgang mit den eigenen Kindern seine Rolle als progressiver Vater zu finden, zumal ihm klare Vorbilder dafür fehlen.
Paul Brodowsky erzählt in seinem Roman Väter von einem Jahrhundert deutscher Geschichte. Er verdichtet Erinnerungen, Recherchen und Reflexionen zu einem Bild der BRD nach der Zeit des Nationalsozialismus - er arbeitet auf, was in vielen Familien bis heute verschwiegen wird, und spannt so den Bogen von den dreißiger Jahren bis zur Gegenwart. Eine schonungslose Selbstbefragung und Spurensuche nach den Prägungen durch die Großväter und Väter.
Paul Brodowsky erzählt in seinem Roman Väter von einem Jahrhundert deutscher Geschichte. Er verdichtet Erinnerungen, Recherchen und Reflexionen zu einem Bild der BRD nach der Zeit des Nationalsozialismus - er arbeitet auf, was in vielen Familien bis heute verschwiegen wird, und spannt so den Bogen von den dreißiger Jahren bis zur Gegenwart. Eine schonungslose Selbstbefragung und Spurensuche nach den Prägungen durch die Großväter und Väter.