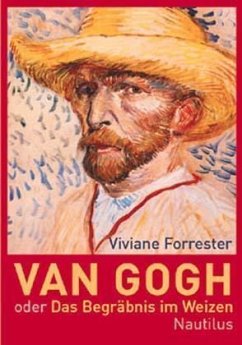Van Gogh ist kein Maler, sondern ein Erfinder der Malerei! Viviane Forrester geht unter die Oberfläche. Sie spürt dem Wesen van Goghs nach, dem Grund für seine Schaffensfreude, Malwut, seine Ängste und Krisen. Der Künstler und der Mensch van Gogh bekommen eine berührende und faszinierende Dimension.

Stefan Koldehoff erzählt, wie Van Gogh zum Mythos wurde, Viviane Forrester inszeniert eine Heldenschmonzette / Von Niklas Maak
Für die Schriftsteller ist eine Sache auf jeden Fall klar. Die Sonne hat ihm das Gehirn verbrannt. Erst die Haare, dann das Gehirn. Zu heiß sei es für den gebürtigen Niederländer in Südfrankreich gewesen, nicht nur seine Farbe, auch sein Kopf sei in Arles irgendwann übergekocht. Daß das so war, daran hatten auch angesehene Schriftsteller wie der Kunsthistoriker und Schriftsteller Julius Meier-Graefe keine Zweifel. Meier-Graefe legte Vincent Van Goghs Arzt eine Erklärung in den Mund, die dieser so nie abgegeben hat, die aber die Zeitgenossen des ersten Van-Gogh-Biographen durchaus zu überzeugen schien. Das Unheil wird damit erklärt, "daß Vincent der Terpentingeruch geschadet habe. Auch soll ihm das Malen unter freiem Himmel nicht förderlich gewesen sein; er konnte der Gewohnheit nicht widerstehen, beim Malen den Hut vom Kopfe zu reißen, und die Sonne hatte ihm schließlich alle Haare vom Schädel gebrannt, so daß sie zuletzt von dem Gehirn nur durch eine dünne Knochenschale getrennt war."
Die übermäßig besonnte Künstlerglatze als Vorstufe des Wahnsinns war nur eine von zahllosen Erklärungen, die durch die Literatur über Van Gogh spukten. Kaum ein Maler ist von der Nachwelt so mythifiziert worden wie Van Gogh, das Bild vom unverstandenen, einsamen, ohrabschneidenden Malergenie, das mit heißem Schädel halbirre Geniestreiche auf die Leinwand donnert, hat sich in unzähligen Filmen, Romanen und Biographien festgesetzt. Jetzt, zum hundertfünfzigsten Geburtstag des Malers, widmet sich der Kunsthistoriker und Radiojournalist Stefan Koldehoff in einer weiteren Publikation vor allem der Rezeption Van Goghs, seiner beispiellosen postumen Karriere auf dem Kunstmarkt und der Mythenbildung nach seinem Tod - was zunächst einmal nicht besonders aufregend klingt. Seit zwanzig Jahren gehört es zum guten Ton bei Rezensenten und Kunstwissenschaftlern, die sich mit Van Gogh befassen, "mit den Mythen aufzuräumen", so daß Van Gogh nun zu den bestaufgeräumtesten Figuren der Kunstgeschichte gehört und man sich wünscht, jemand möge nach der umfangreichen Mythenbekämpfung einmal wieder erklären, worin die Bedeutung dieses Werkes liege.
Koldehoff beschränkt aber sich dankenswerterweise nicht darauf, zum hundertsten Mal zu betonen, daß Van Gogh sich erstens nicht das Ohr abgeschnitten hat (es war nur ein Teil des Ohres), zweitens kein erfolgloser Einzelgänger war (er war einer der "Maler des Petit Boulevard", die sich als Quasibewegung gegen die Impressionisten abgrenzen wollten), drittens zu Lebzeiten mehr als ein Bild verkaufte (es könnten bis zu zehn gewesen sein, was man aber nicht genau beweisen kann) und viertens nicht plötzlich dem Wahnsinn, sondern, befödert durch massive Absinthbesäufnisse, langsam einer "psychiatrischen Funktionsstörung" verfiel, was immer das heißen mag.
Koldehoffs Buch ist in einer präzisen und verständlichen Sprache verfaßt; stellenweise liest es sich wie ein Kriminalroman. Über die Rolle der Schwägerin Johanna Van Gogh, Meier-Graefes Van-Gogh-Mythifizierung und den Durchbruch auf dem Kunstmarkt kommt Koldehoff zu dem spannenden Kapitel der Van-Gogh-Fälschungen. 1928 hatte der junge Kunsthändler Otto Wacker vier gefälschte Van Goghs in eine Ausstellung in der Kunsthandlung Cassirer geschmuggelt; Grete Ring meldete beim ersten Rundgang durch die Schau Zweifel an der Qualität der Wacker-Bilder an. Die Zweifel bestätigten sich. Wacker war bereits früher einmal verhaftet worden, als er ein gefälschtes Gemälde von Franz von Stuck verkaufte. Danach schlug Wacker sich als Tänzer durch, bis er in den Handel mit Van Gogh-Gemälden einstieg, die damals zu Preisen ab 25 000 Mark gehandelt wurden. Die Entdeckung der falschen Van Goghs - insgesamt soll es über dreißig Wacker-Van-Goghs gegeben haben - setzte auch Meier-Graefe unter Druck, der bedenkenlos Echtheitszertifikate ausgestellt hatte. Der Prozeß führte zu einer so präzisen Beschäftigung mit Van Goghs Werk, wie es sie zuvor kaum gegeben hatte - mit Röntgenaufnahmen, Stilanalysen und Leinwandproben. Am Ende erhielt Wacker eine Gefängnis- und eine Geldstrafe von 30 000 Mark, Meier-Graefe war blamiert.
Es ist erhellend zu verfolgen, wie Koldehoff in seiner rezeptionsgeschichtlichen Grundlagenarbeit die Mythenschreibung mit dem kunsthistorischen Skalpell zerlegt. "Ein rasendes Temperament hat sie auf die Leinwand geschleudert", schreibt Meier-Graefe über Van Goghs Bilder und gab damit einen Ton an, der lange die Van-Gogh-Literatur prägte. "Bäume schreien, Wolken jagen entsetzt. Die Bilder sind oft, man weiß es, im blinden Taumel gemalt." Dabei, das zeigt Koldehoff mit Verweis auf Röntgenanalysen, hat Van Gogh lange an Kompositionen gearbeitet und unzählige Vorzeichnungen angefertigt. Van Gogh, der Autodidakt, übte sich in Kopien der Werke Millets, zeichnete minutiös japanische Holzschnitte ab und speiste all dies ein in die Suche nach einem eigenen Stil.
Manchmal wird die Entmythologisierungsarbeit etwas übertrieben. Die Tatsache, daß nach Van Goghs Tod siebenunddreißig Kondolenzschreiben bei der Familie eingingen, reicht kaum, um die Behauptung, Van Gogh sei zu Lebzeiten erfolglos geblieben, ins Reich der Mythen zu verjagen. Auch daß Van Gogh es schaffte, die mittellose, schwangere Prostituierte Clasina Hoornik so weit zu bringen, daß sie an ihm "wie eine zahme Taube" hing, macht ihn noch nicht zum Don Juan unter den Kartoffelessern. Koldehoff erwähnt allerdings zu Van Goghs erotischen Gunsten eine unglücklich verliebte Nachbarin, die sich seinetwegen vergiften wollte.
Ganz anders als Koldehoffs Blick auf Van Gogh fällt die Biographie der Französin Viviane Forrester aus. Die 1925 geborene Autorin, die zuletzt den globalisierungskritischen Essay "Der Terror der Ökonomie" veröffentlichte und Gründungsmitglied von Attac ist, schreibt eine psychologisch argumentierende Biographie, die alle Klischees noch einmal aufkocht. Forresters Van Gogh, von dem man nicht wisse, "ob er ein Maler war, ein Schrei oder die Einsamkeit selbst", ist ein Mann ganz nach Meier-Graefe. Die Französin verfolgt die gewagte These, Van Goghs existentielles Unbehagen rühre von der Tatsache her, daß er nur der Wiedergänger eines anderen Vincent Van Gogh war, des am 30. März 1852 totgeborenen älteren Bruders. "Die Schuld nagt an ihm und auch die Gewissensbisse, die nicht lokalisierbar sind . . ., als er empfindet, der Stellvertreter eines toten, begrabenen Vincent zu sein." Natürlich muß Vincents Leben ein "seltsames Leben" sein, eine "glühende und wilde Konstruktion". Die Bilder strahlen "Verletztheit und Lust" aus und sind vergebliche Versuche, "ohne Unterlaß auf die Welt zu kommen". So wird die gesamte neuere Van-Gogh-Literatur in den Sprachmixer schwüler Unheilsprosa gehauen; einen neuen Blick auf den Maler bietet Forresters Buch nicht.
Immer wieder kursierte die These, Van Gogh habe sich aus Liebeskummer umgebracht, und es sei die Familie Gachet gewesen, die den labilen Künstler in den Tod getrieben habe. Van Gogh hatte seine letzten Lebensmonate in Auvers-sur-Oise verbracht, nördlich von Paris. Dort wurde er von dem Arzt Paul-Ferdinand Gachet betreut. Van Goghs Bruder Theo hatte ihn auserkoren, sich um den psychisch immer labileren Vincent zu kümmern, aber der hielt von seinem Doktor nicht allzuviel: "Ich glaube", schrieb Van Gogh erbost, "auf Doktor Gachet darf man in keiner Weise rechnen. Erstens ist er meiner Meinung nach kränker als ich, oder sagen wir, ebenso krank wie ich."
Gachet hatte eine damals einundzwanzigjährige Tochter, Marguerite, die Van Gogh malte. Das Verhältnis war, darf man den Quellen glauben, nicht unproblematisch. Gachets Sohn erzählte 1927 von Van Goghs Besuchen im Haus seines Arztes: "Vincent war kein angenehmer Gast im Hause. Er stritt oft mit dem Vater wegen dessen Vorliebe für Cézanne. Und dann passierte das mit meiner Schwester. Vincent wünschte, ihr Bildnis zu malen. Marguerite war damals gerade erwachsen. Als die Sitzung beginnen sollte, gestand meine Schwester, daß sie Herrn Van Gogh fürchte. Sie schämte sich sehr, es zu sagen, Van Gogh habe ihr gegenüber von Liebe gesprochen. Das hatte eine Aussprache zwischen Vater und Vincent zur Folge."
Koldehoff relativiert die Dramatik dieser Geschichte. Die Entscheidung, sich eine Kugel in den Bauch zu schießen, habe andere Gründe. Van Gogh habe in Paris seinen Bruder Theo, dessen Frau und deren Sohn Vincent Wilhelm besucht und gespürt, daß Theos finanzielle und emotionale Zuwendung an ihn zugunsten seiner Familie nachließ. In einem Brief macht Vincent dem Bruder deshalb Vorhaltungen. Theo plant, seine Stellung bei dem Kunsthändler Goupil aufzugeben, und schreibt seinem Bruder schließlich einen grimmigen Brief; aufgrund der auch deshalb einsetzenden Existenzangst, in Verbindung mit der Frustration darüber, die sich selbstgesteckten Ziele verfehlt zu haben, vermutet Koldehoff, sei es bei Vincent zu einer Kurzschlußreaktion gekommen.
Bei Forrester heißt das: "Dieser Tod, den Theo vielleicht mit diesem gefahrvollen Brief sucht, in dem er zu den verbotenen, geheimen Quellen zurücksteigt, die ihren giftigen Lauf in den verfaulten Wurzeln nehmen gleich denen, die im Schlamm in Drenthe langsam zu Torf werden." Die Lust am Mythos ist so unzerstörbar wie das Bild des irren Genies im Weizenfeld.
Stefan Koldehoff: "Van Gogh". Mythos und Wirklichkeit. Mit einem Beitrag von Nora Koldehoff. DuMont Verlag, Köln 2003. 303 S., 100 Fab- u. S/W-Abb., geb., 34,90 [Euro].
Viviane Forrester: "Van Gogh oder Das Begräbnis im Weizen". Aus dem Französischen von Gerhard Stange. Edition Nautilus, Hamburg 2003. 349 S., 20 S/W-Abb., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Anlässlich des hundertfünfzigsten Geburtstags von Van Gogh ist neben Stefan Koldehoffs "Van Gogh. Mythos und Wirklichkeit" eine weitere Arbeit über den Künstler erschienen: Viviane Forresters Biografie "Van Gogh oder das Begräbnis im Weizen". Im Unterschied zu Koldenhoffs Buch lässt Rezensent Niklas Maak an Forresters Biografie kein gutes Haar. Während Koldehoff erzähle, wie Van Gogh zum Mythos wurde, inszeniere Forrester eine "Heldenschmonzette". Ihre psychologisch argumentierende Biografie kocht zum Ärger Maaks noch einmal alle gängigen Van-Gogh-Klischees auf. Von Van Gogh wisse man nicht, "ob er ein Maler war, ein Schrei oder die Einsamkeit selbst", zitiert Maak die Autorin, um den Stil ihrer Darstellung zu illustrieren. Er kommt zu dem Schluss, bei Forrester werde die gesamte neuere Van-Gogh-Literatur durch den "Sprachmixer schwüler Unheilsprosa" getrieben. Einen neuen Blick auf den Maler bietet das Buch nach Einschätzung des Rezensenten dabei nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"