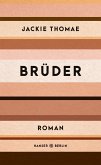Sie weiß alles, sie kriegt alles, sie durchschaut jeden. Nur sich selbst durchschaut sie nicht: Eine Geistesgestörte, wie es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch und zutiefst manipulativ.
Die Polizei hat sie hergebracht, in die psychiatrische Abteilung des alten Wiener Spitals. Nun erzählt sie dem Chefpsychiater Doktor Korb, warum es so kommen musste. Sie spricht vom Aufwachsen in der erzkatholischen Kärntner Dorfidylle. Vom Zusammenleben mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder Bernhard, den sie unbedingt retten will. Auf den Vater allerdings ist sie nicht gut zu sprechen. Töten will sie ihn am liebsten. Das behauptet sie zumindest. Denn manchmal ist die Frage nach Wahrheit oder Lüge selbst für den Leser nicht zu unterscheiden. In ihrem fulminanten Debüt lässt Angela Lehner eine Geistesgestörte auftreten, wie es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch, besserwisserisch und zutiefst manipulativ.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Die Polizei hat sie hergebracht, in die psychiatrische Abteilung des alten Wiener Spitals. Nun erzählt sie dem Chefpsychiater Doktor Korb, warum es so kommen musste. Sie spricht vom Aufwachsen in der erzkatholischen Kärntner Dorfidylle. Vom Zusammenleben mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder Bernhard, den sie unbedingt retten will. Auf den Vater allerdings ist sie nicht gut zu sprechen. Töten will sie ihn am liebsten. Das behauptet sie zumindest. Denn manchmal ist die Frage nach Wahrheit oder Lüge selbst für den Leser nicht zu unterscheiden. In ihrem fulminanten Debüt lässt Angela Lehner eine Geistesgestörte auftreten, wie es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch, besserwisserisch und zutiefst manipulativ.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Daniela Strigl zeigt sich beeindruckt von Angela Lehners Vaterabrechnung. In die Fußstapfen von Peter Henisch und Josef Winkler scheint die Autorin mit ihrem Debüt durchaus hineinzupassen, behauptet Strigl. Dass Lehner mit dem Steinhof das Setting einer berüchtigten psychiatrischen Klinik wählt, in dem sie ihre manische Heldin rotzig über Ärzte und Patienten herziehen und die Kärntner Kindheit memorieren lässt, scheint Strigl zu gefallen, zumal Lehners Figur keine Larmoyanz zeigt. Klischeefrei schließlich gelangt die Erinnerung zum laut Strigl absichtsvoll undeutlichen Bild des Familienoberhaupts als kettenrauchendem Verschweiger. Für die Rezensentin ein respektables Debüt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Longlist des Deutschen Buchpreises hat ein prägendes Thema: das Dorf. Warum ist es so inspirierend für die neue Literatur? Eine kursorische Lektüre.
Würde man "das Dorf" als Thema aus der Longlist des Deutschen Buchpreises herausstreichen, wäre sie im Handumdrehen eine Shortlist. Denn allen Horrormeldungen über abgehängte Regionen zum Trotz steht das Dorf in der Hälfte der - möglicherweise von einer tendenziell stadtflüchtigen Jury ausgewählten - Gegenwartsromane im Zentrum des Geschehens. Ohne die Provinz, den Phantasieraum "Land", das einsame Haus am See und die menschlichen Konstellationen, die all diese abgelegenen Räume ermöglichen, hat die deutsche Literatur im Moment scheinbar wenig zu erzählen.
Das ist zum einen nicht verwunderlich. Haben ländliche Gebiete in sich vereinzelnden Gesellschaften doch den großen Vorteil: Hier kann man den Menschen noch beim Leben zuschauen, bei der Gartenarbeit, beim Häuserbauen, beim Kindergroßziehen. Und auch wenn selbst auf dem Land inzwischen alle ständig aufs Handy starren, ist die Natur mit ihrer zuversichtlich stimmenden, erneuernden Kraft doch immer noch unausweichlich - wenn auch auf dem Feld mit Dünger und Glyphosat nachgeholfen wird. Vergleicht man die Biographien einiger Autoren mit ihren Büchern, fällt auf, dass die Dorfherkunft zunehmend als eine Art Migrationshintergrund inszeniert wird. Wer vom Land kommt, verfügt über immer attraktiver werdendes Geheimwissen, das man bei Bedarf auch ins Surreale drehen kann.
Kinofilme wie zuletzt "25 km/h" bedienen das damit verbundene Entschleunigungsklischee etwas zu beflissen. Spannender ist es, sich zum Beispiel die Langzeitreportagereise von Franz Xaver Gernstl durch deutsche Randgebiete im Bayerischen Fernsehen anzuschauen, bei der einen nicht selten das Gefühl beschleicht: Die wahre Subversion, der echte Zeitgeistwiderstand, die interessantesten Menschen kommen aus der Provinz. Von dieser widerständigen, schildbürgerhaften Tendenz ist in den Romanen der Longlist allerdings nicht viel zu spüren.
Vor allem die Uckermark hat es vielen angetan. Dort steht nicht nur der von Lola Randl beschriebene "Große Garten", auch das Wochenendhaus der beiden Hauptfiguren in Miku Sophie Kühmels "Kintsugi" ist dort angesiedelt, und in "Gelenke des Lichts" von Emanuel Maeß kommt die dünnbesiedelte Gegend zumindest in einer Nebenepisode vor. Ansonsten spielt dieser letzte Roman, eine laut Klappentext "Provinzidylle im Schatten des Eisernen Vorhangs", in Urspring an der Werra, also ziemlich genau in der ländlichen Mitte Deutschlands. Was allerdings eine Ausnahme unter den übrigen Dorfgeschichten darstellt, die fast konsequent in hochgelegene Randlagen führen: in die Eifel ("Winterbienen" von Norbert Scheuer), das "erzkatholische Kärnten" ("Vater unser" von Angela Lehner), ein Bergdorf im westlichsten Zipfel Bosniens ("Herkunft" von Sasa Stanisic), auf eine zurückgebliebene griechische Insel ("Miroloi" von Karen Köhler) und bis zum Berg Ararat ("Hier sind Löwen" von Katerina Poladjan). Noch extremer ist die Lage in Raphaela Edelbauers Roman "Das flüssige Land". Denn wo genau der kleine Gebirgsort Groß-Einland liegt, weiß kein Mensch, nicht einmal die "Österreichische Bundesverwaltung".
Mit dem Titel "Herkunft" benennt Sasa Stanisic, der für seinen 2014 erschienenen Roman "Vor dem Fest" ja auch schon ein Dorf in der Uckermark unter die Lupe genommen hat, das Thema vieler der genannten Bücher. Wobei das Besondere an Stanisics Perspektive darin besteht, dass seine Stoffe sowohl mit der eigenen Migrationsgeschichte verbunden sind als auch immer wieder mit der Bezugsgröße "Dorf", das er aber - aufgewachsen in Visegrad und Heidelberg - aus eigenem Erleben kaum kennt.
In "Herkunft" heißt dieses Dorf Oskorusa und ist der Heimatort von Stanisics väterlichen Vorfahren. Doch der im vierten Kapitel unternommene und dann im Buch immer wieder aufgegriffene Besuch in diesem bosnischen Bergdorf ist keine irgendwie kathartisch wirkende Pilgerreise. Vielmehr wehrt sich der Ich-Erzähler an Ort und Stelle gegen jede Form von "Zugehörigkeits-" und "Herkunftskitsch".
Andererseits bietet ihm die ländliche Kulisse des Bergdorfs Anlass für Sätze wie diesen, in dem der Auftritt Gavrilos, eines mit dem Ort verwachsenen Verwandten, beschrieben wird: "Ein junger Mann, der immer älter wurde, je näher er kam. In seinem Bart steckten Tannennadeln." Wo anders wären solche Zeit und Raum, Geschichte und Natur verflechtenden Sätze denkbar als in dieser urtümlichen Gegend? Und Gavrilo hat noch eine weitere Herausforderung für den Erzähler parat, denn er ist der Meinung, dass man dort, wo der eigene Urgroßvater einen Brunnen gegraben hat, seine Herkunftssuche beenden sollte. Dabei wird deutlich: Heimatgefühl lässt sich nicht rational begründen, es ist gewissermaßen selbsterklärend, tendenziell tautologisch. Was es sowohl gefährlich macht als auch, wie in Stanisics Buch, immer wieder komisch, somit erträglich und, auf ironischen Umwegen, sogar beruhigend.
Wie anders erlebt Eva Gruber, die Hauptfigur aus Angela Lehners Roman "Vater unser", ihre dörfliche Herkunft. Die junge Frau, die gerade von der Polizei in die Psychiatrie gebracht werden soll, weil sie behauptet, eine Kindergartengruppe umgebracht zu haben, beschreibt bei einem Zwischenhalt an einer ländlichen Tankstelle folgende Szene: "Mein Blick trifft auf einen kleinen Altar, der auf einer leeren Villacher Bier-Kiste eingerichtet ist. Auf einem handbestickten Tischtuch liegt ein Rosenkranz neben einem gerahmten Porträtfoto von Jörg Haider. Darüber hängt ein kleiner Jesus auf einem Kreuz herum. ,Mein Gott', sag ich, ,sind wir in Kärnten.'" Hier wird das Ländliche von Anfang an als Klischee ins Bild gesetzt, man meint die inszenierte Pointe für spätere Dichterlesungen herauszuhören.
Ansonsten spielt die Handlung im Wiener Otto-Wagner-Spital, das man aus Thomas Bernhards Erzählung "Wittgensteins Neffe" kennt. In einem Radiointerview wurde die in Osttirol aufgewachsene, heute in Berlin lebende Autorin gefragt, ob man den geographischen Abstand brauche, um über "österreichische Klischeethemen" zu schreiben? Lehner verneint: "Ich hatte ja nicht vor, einen Roman über Kärnten oder Österreich zu schreiben. Das Thema ist viel eher aus der Eva-Gruber-Figur entstanden. Ich bin irgendwann wirklich dagesessen und hab mir gedacht: ,Huch, jetzt sitzen die auf der Baumgartner Höhe!'" Dabei ist die Psychiatrische Klinik, in der die Kindheitstraumata einer Dorfjugend geheilt werden sollen, dramaturgisch gesehen nichts anderes als ein Dorf in der Stadt mit noch weniger Privatsphäre.
Der gallige Blick auf die österreichische Provinz in der Tradition Thomas Bernhards oder Elfriede Jelineks durchzieht auch Raphaela Edelbauers Roman "Das flüssige Land". Auch hier ist der beschränkte Ort der Vorfahren einer, von dem man nicht loskommt. Und so zögert die Erzählerin im "Flüssigen Land" keinen Moment, als es darum geht, dem Wunsch der Eltern nach Bestattung im lebenslang verdrängten Kindheitsort Groß-Einland nachzukommen. Bemerkenswert ist nun, wie die Autorin ihren eigenen Geburtsort - das niederösterreichische Hinterbrühl mit seinem unterirdischen See und seiner Burg Liechtenstein - kafkaesk auflädt und in einer an Fernsehserien wie "Dark" oder "Stranger Things" erinnernden Handlung regelrecht neu entdeckt.
Ist für Schriftsteller wie Sasa Stanisic und Raphaela Edelbauer nun der Stadtflucht oder der Landflucht der Vorzug zu geben? Das ist schwer zu entscheiden. Auch Angela Lehners Land-Stadt-Land-Bewegung hebt die Grenzen auf. Übertroffen wird dieses literarische Pendeln zwischen den Welten aber noch von der in München geborenen, in einer oberpfälzischen Ökokommune aufgewachsenen, heute in der Uckermark lebenden Lola Randl. Bei ihr haben wir es biographisch und literarisch mit einem Stadt-Land-Stadt-Land-Hopping zu tun.
Wie hybrid diese Lebensform ist, beschreibt Randl in ihrem Buch selbst. Das ausgestorbene Dorf in der Uckermark mit den günstigen Häuserpreisen lädt zunächst zur Naturromantik ein, doch die Städter, die es bevölkern, errichten in ihm gleichzeitig eine Parallelgesellschaft, die das Ursprüngliche bedroht. Die weltliterarische Tradition des Rückzugs in den Garten wird auch bei anderen Longlist-Romanen um eine Art Speckgürtel-Perspektive erweitert. Fluchtmöglichkeiten gibt es in beide Richtungen.
Wo aber bleibt der poetische Spürsinn für den zeitkritischen Konflikt zwischen Regionalität und Mobilität, der sich auf dem Dorf, siehe Gelbwesten, besonders radikal bemerkbar macht? In der Longlist kommt er als strukturelles Schreckgespenst eigentlich nur in Karen Köhlers Roman "Miroloi" vor. Die Autorin beschreibt hier eine bedrohlich-patriarchale religiöse Gemeinschaft auf einer abgeschotteten griechischen Insel vor Einführung von Fernsehen und Coca-Cola. Erstaunlich dabei, dass die biographisch urban geprägte Autorin der bäuerlichen Lebensweise trotz allem durchaus offen gegenübersteht. Ihr Buch, sagte sie im Radiointeview, gebe auch "eine Ahnung davon", wie ein Leben aussähe, in dem "Lebensmittel nicht mehr so leicht verfügbar" seien, und verweist auf die Prognose von Zukunftsforschern, "dass jeder Mensch einen Teil der Lebensmittel, die er verbraucht, selbst anbauen werden" müsse.
Dazu passt, dass der schon von Walt Whitman bedichtete "Kompost" bei Randl, Kühmel und Köhler vorkommt und im Garten vor sich hin wächst. Man kann sogar sagen: Das Dorf selbst ist zum Komposthaufen der deutschen Literatur geworden. Alles Mögliche kann auf ihn draufgeworfen, projiziert und von ihm abgeerntet werden. Das ist weder originell noch verwerflich. Guten Humus gibt es aber nur, wenn man den Kompost genau beobachtet und regelmäßig umsetzt.
UWE EBBINGHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Angela Lehners fulminanter Debütroman, unsentimental, frech und direkt erzählt, ist Familiengeschichte, Krankenhausreport und Krimi in einem." Jury des Österreichischen Buchpreises "Angela Lehner spielt das literarische Spiel mit der unzuverlässigen Erzählerin bis zuletzt stimmig und über weite Strecken fesselnd durch. Thematisch darf man sich an Thomas Bernhard oder Josef Winkler erinnert fühlen." Sebastian Fasthuber, Falter, 11.09.19 "Angela Lehner erschafft eine Frau, die einem noch lange im Kopf herumspukt. Womöglich sogar eine Figur, die in das literarische Gedächtnis dieses Landes eingehen wird. [...] Ein brillanter Roman über seelisches Leid - und über die kranke Welt, in der wir leben." Andrea Heinz, Der Standard, 08.06.2019 "Die Verunsicherung, die entsteht, wenn die einzige verfügbare Perspektive, jene einer Verrückten ist, macht den Roman äußerst reizvoll. Dass es sich um ein Debüt handelt, merkt man dem Text nicht an. Lehner spielt gekonnt mit literarischen Traditionen, Genres und Motiven." Veronika Schuchter, Deutschlandfunk, 09.04.19 "Als Leser kann man sich nur schwer von Eva Grubers Perspektive lösen - und das ist das Glück dieses Debüts. Man kann ...'Vater Unser' allerdings schnell auch ein zweites Mal lesen. Beim zweiten Mal wäre es - und das schaffen nicht viele Bücher - womöglich ein anderes." Julia Friese, Spiegel Online, 05.04.19 "'Vater unser' ... beschreitet eigene Wege, als fiktive Geschichte der Leerstellen und falschen Sicherheiten, als ironisch getönte Milieustudie im psychiatrischen Klinikalltag. ... Der Leser bleibt mit den eigenen Sinnestäuschungen zurück, ein bisschen verstört, ein bisschen ratlos und ziemlich beeindruckt." Daniela Strigl, Süddeutsche Zeitung, 18.03.19 "Ein Roman, der lakonisch kommentiert ohne dabei sein Feingefühl für Figuren und Konfliktlinien zu verlieren. Ein Debüt, das berührt und unterhält und wie man es gern öfter lesen würde." Miriam Zeh, SWR2 Lesenswert, 22.02.19 "'Vater unser' hat etwas, das andere Romane nicht zusammenbringen: er verweht nicht nach der letzten Seite. Die Unsicherheit, die er auslöst, bleibt im Kopf, Eva Gruber - um die 25 Jahre alt, hochintelligent - bleibt im Kopf." Peter Pisa, Kurier, 23.02.19